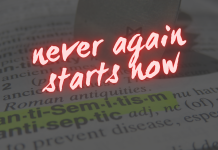1997 fand die Humanbiologin und Anthropologin Margit Berner in den Beständen des Naturhistorischen Museums Wien eine kleine Schachtel. „Nicht öffnen“ stand auf allen Seiten darauf – sie tat es trotzdem. Darin wurden Fotos aufbewahrt, die sie für Jahrzehnte nicht loslassen sollten. Sie zeigten hunderte Frauen, Männer, Kinder, die so abgelichtet worden waren, als wären sie Verbrecher. Wie sich herausstellte, hatte man sie im Rahmen eines Projekts zur Erforschung „typischer Ostjuden“ nicht nur fotografiert (auch nackt), sondern ebenso vermessen und ihre Fingerabdrücke dokumentiert.
»Ein Aufruf an die Wissenschaft, Position zu beziehen.«
Die Ausstellung Der kalte Blick. Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnów erzählt diese grausame Episode des Nationalsozialismus nun im Haus der Geschichte Österreich (hdgö). Was die Schau auszeichnet: hier werden Täter- und Opfergeschichten erzählt, hier wird der Bogen vom jüdischen Leben in Tarnów vor der NS-Zeit bis zum Gedenken heute gespannt. Gedanken gemacht hat man sich dabei, wie die historischen Aufnahmen zwar gezeigt, die Opfer von damals aber nicht erneut zum Objekt degradiert werden.
Die Fotos können daher nun vom Besucher im Rahmen der Schau nicht frontal betrachtet werden, sie bilden vielmehr ein Memorial, eine Gedenkinstallation, in der sie so montiert wurden, dass nur ein seitlicher, nicht vollständiger Blick möglich ist. „Mir war es wichtig, diese Menschen nicht noch einmal als Opfer vorzuführen“, sagte Berner bei der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der Ausstellung, die in Wien als Kooperation des hdgö und des Naturhistorischen Museums organisiert wurde. Zuvor war die Schau bereits in Berlin zu sehen.
Die Fotos seien auch Dokumentation einer Form von Gewalt, betonte hdgö-Direktorin Monika Sommer, dabei handle es sich um „wissenschaftliche Gewalt“. Und Katrin Vohland, Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums betonte: „Die Ausstellung ist nicht nur eine Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, sie ist auch ein Aufruf an die Wissenschaft, Position zu beziehen und unterschwellige Vorurteile zu identifizieren. Speziell die Anthropologie als umkämpftes und nach vielen Seiten offenes Forschungsfeld bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen naturwissenschaftlicher Exaktheit von Messdaten und deren Interpretation durch unterschiedliche Akteure über einem Abgrund aus Vorurteilen und unreflektierten Erfahrungen.“
Es waren zwei Wiener Wissenschafterinnen, Dora Maria Kahlich und Elfriede Fliehtmann, die 1942 die Vermessung und Ablichtung von 106 Familien – insgesamt 565 Frauen, Männern, Kindern – veranlassten. Ihr Umgang mit diesen Menschen zeugt von Kaltblütigkeit und Entmenschlichung. „Wir wissen nicht, welche Maßnahmen über die Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung für die nächsten Monate geplant sind, unter Umständen könnte uns durch zu langes Warten wertvolles Material entgehen“, schrieb Anton Plügel, ebenfalls ein Wiener Anthropologe, im Oktober 1941 an seine Kollegin Kahlich. Plügl arbeitete zu der Zeit am 1940 in Krakau eröffneten Institut für Deutsche Ostarbeit. Dieses entwickelte im Sommer 1941 in Kooperation mit dem Anthropologischen Institut der Universität Wien das Projekt zur „Erforschung typischer Ostjuden“, Plügel kümmerte sich um die Koordination in Polen.
Das Team bemühte sich also, noch rasch seine Messungen und Aufnahmen machen zu können – Fotograf war Rudolf Dodenhoff, der nach Kriegsende in seine Heimat, das Künstlerdorf Worpswede zurückkehrte und weiter als Fotograf arbeitete. „Eines Tages mussten wir zu den Deutschen zum Fotografieren gehen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Sie nahmen uns alle nackt auf“, erzählte Rachela Engelhardt, geb. Goldstein, 1996. Sie zählte zu den nur 26 Überlebenden der 565 zu rassenkundlichen Objekten missbrauchten Menschen.
Wie sehr hier Menschen als Objekt betrachtet wurden, belegen diese Zitate: „Bei uns ist die Arbeit in vollem Gange, an den Juden wird wild gerechnet“, schrieb Kahlich im September 1942 aus Wien an Fliethmann, die sich in Polen aufhielt. Und Fliethmann schrieb im Oktober 1942 ihrerseits an Kahlich: „In Galizien kann ich auch keine Juden mehr untersuchen. Von den Tarnówern sind im Ganzen noch 8.000 da, aber wie mir (SD-Chef Willi, Anm.) Bernhardt sagte, von unseren fast niemand mehr. Unser Material hat also heute schon Seltenheitswert.“ Der Briefwechsel der beiden Wissenschafterinnen wurde übrigens schon vor dem Fund der Fotos durch Berner von Götz Aly und Susanne Heim herausgegeben.
Was der Ausstellung gut gelingt, ist dieser Entmenschlichung Menschlichkeit, oder wie es Vohland formuliert, „den warmen Blick“ entgegenzusetzen. Berner recherchierte in akribischer Detailarbeit die Geschichten aller betroffenen Familien, so finden sich in der Ausstellung auch Familienbilder und eben auch Erinnerungen jener wenigen, die überlebt haben. Da erzählte etwa Frania Eisenbach-Haverland 2011: „Nach 60 Jahren, im Sommer 2002, erhielt ich aus Wien neue Informationen über meine Familie. Das war ein Schock. Ich sah mein eigenes Bild, die Bilder meiner Brüder und meiner Eltern, aber ich habe keine Erinnerung, wie und unter welchen Umständen diese Fotos entstanden.“
BUCHTIPP
Margit Berner: Letzte Bilder. Final Pictures. Die „rassenkundliche“ Untersuchung jüdischer Familien im Ghetto Tarnów 1942“; Berlin 2020; Verlag Hentrich & Hentrich
294 Seiten; ISBN 978-3-95565-407-8; € 22,-