
Ich bin Kapitän Rickover. Ich bin dumm.“ Mit diesen knappen Sätzen stellte sich Hyman Rickover Edward Teller vor, dem bekannten Nuklearwissenschaftler, der später als Vater der Wasserstoffbombe bezeichnet werden sollte. Es war sicher Ehrfurcht vor Teller, die ihn so sprechen ließ, aber wohl auch ein Gutteil Koketterie des drahtigen, klein gewachsenen Marineingenieurs.
Rickover war freilich kein einfacher Offizier der US-Kriegsmarine. Er hielt bereits einen Master-Abschluss in Elektrotechnik der Columbia University. Und er hatte sich schon intensiv in das neue Feld der Nukleartechnik eingelesen. Doch anders als die tausenden Ingenieure des Manhattan-Projekts, die sich während des Zweiten Weltkriegs ausschließlich auf die Entwicklung der Bombe konzentriert hatten, wollte er etwas ganz anderes: die neue Energie zum Antrieb von U-Booten und – später – Überwasserschiffen bändigen.
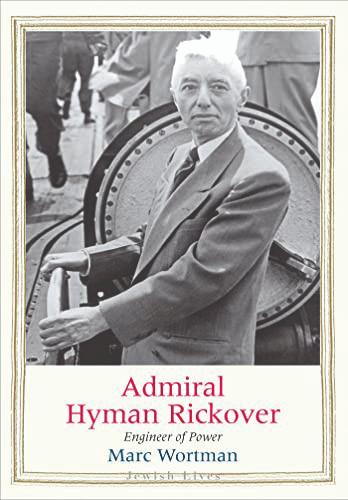
Das Umfeld dafür war alles andere als bereitet. Mit Kriegsende wurde die USMarine drastisch redimensioniert, auf etwa ein Zehntel des Stands von 1945. Und Rickover hatte dabei seinen organisatorischen Anteil. Für die Männer zur See war der Ausblick auch in einem größeren strategischen Feld äußerst ungünstig. Der Sieg über Japan durch den Abwurf der beiden Atombomben hatte die Prioritäten Washingtons ganz klar in Richtung Kernwaffen und Bomber gelegt. Zwar hatte es schon zu Kriegsbeginn in den USA erste – sehr theoretische – Überlegungen zum Einsatz der Atomenergie als Antriebsmittel für große Schiffe gegeben, doch diese waren inzwischen fast völlig in den Hintergrund getreten. Mit dem Nachziehen der Sowjetunion auf dem Gebiet der nuklearen Bewaffnung wurde diesen Gedanken wieder neuer Auftrieb gegeben. Rickover erkannte seine Chance.
„Er war kein Mensch technischer Details“, erinnerte sich später ein enger Mitarbeiter an ihn. „Er war ein meisterhafter Politiker und ein Experte dafür, Dinge durchzusetzen, auch dafür, welche technische Option zu unterstützen.“
Rickover selbst meinte damals: „Ich weiß bereits mehr als alle Firmenchefs und Regierungsbeamten, mit denen ich zu tun haben werde.“ Und er nutzte seine Chance als Leiter des Marine-Reaktorenprogramms, eine Chance, die vom Großteil der Navy-Hierarchie äußerst gering eingeschätzt wurde. Wenn es möglich sein sollte, einmal ein Schiff mit der neuen Technologie über die Meere fahren zu lassen, dann würde das noch Jahrzehnte dauern. Rickover legte sich frech fest: Anfang 1955 würde ein Atom-getriebenes Unterseeboot vom Stapel laufen.
„Er war ein meisterhafter Politiker und ein Experte
dafür, Dinge durchzusetzen.“
Ein enger Mitarbeiter über Hyman Rickover
Dafür brauchte es nicht nur viel Geld, das der Marinemanager, der meist im Anzug ins Büro kam, sich mit intensivem Lobbying über die Köpfe seiner Vorgesetzten hinweg in Washington beim Kongress besorgte. Es brauchte Grundlagenforschung, Heerscharen ziviler Ingenieure, ein intensives Schulungsprogramm für Techniker der Marine selbst und dann konkrete Pläne zur Konstruktion des Reaktors wie des neuen Bootes. Der Reaktor durfte nicht zu groß sein, sonst würde er nicht in die enge Hülle eines Unterwasserfahrzeugs passen, und er müsste so gut abgeschirmt sein, damit die Besatzung, die ja monatelang unmittelbar daneben arbeiten und leben würde, keinen Schaden nehmen dürfe. Schließlich müssten alle Systeme auf extreme Sicherheit ausgelegt sein, der Reaktor dürfe weder bei schwerer See, im Gefecht noch bei Wartungsarbeiten im Hafen irgendeine Gefahr darstellen. Er habe selbst einen Sohn, sagte Rickover einmal, und alles an Bord müsse so sicher sein, dass er seinen Sohn ohne Bedenken dort einsetzen würde.
Besessener Dickschädel. Für diese Riesenaufgabe, quasi aus dem Nichts ein derart komplexes Programm aufzubauen, brauchte es mehr als nur einen nüchternen, kühlen Manager. Es brauchte einen überzeugten, um nicht zu sagen besessenen Dickschädel. Und das war Rickover. Er hatte sein Organisationstalent schon zu Kriegszeiten bewiesen, als er als stellvertretender Leiter der Elektroabteilung des Marinebüros in Washington mit zahlreichen Werften und Lieferanten verhandelte. Und er tat dies stets mit äußerster Schärfe und ohne jede Kompromissbereitschaft. Der Vorstand eines großen Industriebetriebs sagte einmal zu einem Reporter: „Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich Rickover nicht mag. Ich hasse ihn.“
Auch intern war er alles andere als ein angenehmer Chef. Er brüllte seine Befehle im Büro und über das Telefon, legte grußlos auf, kontrollierte immer wieder peinlich genau Mitarbeiter und Zulieferteile. Was funktioniere, interessiere ihn nicht, nur was nicht klappe, so Rickover. Am schlimmsten führte er sich beim Rekrutieren von Personal auf. Er suchte Mitarbeiter, die selbstständig denken konnten und nicht nur auswendig Gelerntes wiedergaben. Dabei machte er immer wieder die jungen Ingenieure herunter, die sich vorstellten, drängte sie auf die unterschiedlichsten Arten in die Defensive, entschied oft sehr spontan und ruppig, wen er nicht brauchen könne und wer bleiben dürfe. Legende wurde sogar der Bewerbungsstuhl, dem er die vorderen Beine gekürzt hatte, damit der Befragte immer wieder wegrutschte und noch zusätzlich verunsichert wurde. Dennoch wollten viele junge Offiziere und auch zivile Ingenieure für ihn arbeiten, Letztere oft zu einem reduzierten Gehalt: Die große Aufgabe ließ sie sogar den Verrückten in Kauf nehmen. Denn auch wenn er jemanden als Mitarbeiter akzeptiert hatte, leichter im täglichen Umgang wurde er auch später nicht.
Was kaum jemand für möglich gehalten hatte:
Im Jänner 1954 taufte Mamie Eisenhower,
die Frau des Präsidenten Dwight D., die „Nautilus“.
Doch es ging etwas weiter. Mehrere Grundsatzentscheidungen fielen. Das U-Boot mit dem ersten Atomantrieb sollte kein Versuchsfahrzeug sein, sondern ein taugliches Kriegsgerät mit Torpedorohren und einer militärischen Besatzung, nicht gesteuert von Wissenschaftlern. In Idaho – weit weg vom Meer – entstand ein modernes Labor mit Versuchsreaktoren, die bereits von der Dimension her jenen in U-Booten entsprachen. Parallel dazu begann eine Werft mit der Detailplanung des Schiffs.
Es sollte sich ausgehen – in sieben Jahren. Was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Im Jänner 1954 taufte Mamie Eisenhower, die Frau des Präsidenten Dwight D., die „Nautilus“. Im Jänner 1955 stach sie in See, setzte sofort eine Reihe von Rekorden in Tauchstrecken, denn das Fehlen von Dieselmotoren und das schier unendliche Angebot von Antriebskraft machte Überwasserfahrten praktisch unnötig.

Die „Nautilus“ errang dann internationalen Ruhm mit ihrer Tauchfahrt unter dem Eis des Nordpols. Die gesamte Taktik des möglichen Seekriegs hatte sich damit verändert. U-Boote konnten nun monatelang unentdeckt zwischen den Kontinenten patrouillieren. Wenige Jahre später kamen noch Interkontinentalraketen dazu, die – unter Wasser abgeschossen – vom Gegner nicht vorweg auszuschalten wären wie die fest verbunkerten an Land. Das Gleichgewicht des Schreckens war damit quasi stabilisiert, ein Erstschlag unwahrscheinlicher geworden.
Die U.S. Navy setzte in den nächsten Jahren voll auf diese Technologie. 1965 waren 102 nuklear betriebene U-Boote oder Überwasserschiffe im Einsatz oder im Bau – zu immensen Kosten. Und daran schieden sich die Geister. So akzeptierte das Verteidigungsministerium Reaktoren für die großen Flugzeugträger, die Begleitschiffe wurden weiterhin konventionell bewegt. Rickover kämpfte für mehr Reaktoren, wurde aber nicht gehört. Sogar Präsident Jimmy Carter, der in der Marine einst als Ingenieur von ihm eingestellt worden war und mit dem er auch später befreundet war, drehte aus Budgetgründen den Bau weiterer Super-Carrier ab. Rickover schaffte zwar, nach einigen Verzögerungen und Blockaden durch die Marinebürokratie, die Beförderungen die Admiralsränge hinauf. Und er legte sich weiterhin mit den privaten Zulieferfirmen an, die seiner Meinung nach die Steuerzahler aussaugten. Aber sein Einfluss schwand, schließlich musste er unter Präsident Ronald Reagan gehen – mit 82 und nach 63 Jahren aktivem Marinedienst. Zuletzt hatte dem stets frugal auftretenden Rickover noch ein Skandal über Geschenke zu schaffen gemacht, die er von den Industrie angenommen hatte. Es war keine große Korruption, aber Fernseher, Schmuckstücke und Möbel summierten sich doch auf einige zehntausend Dollar. Rickover, der bereits in der Arbeit mehrere Herzattacken erlitten hatte, starb 1986 und wurde in Arlington begraben.
VOM STETL ZUR US-MARINE
Chaim Godalia Rykower, Jahrgang 1900, besuchte als Vierjähriger in einem polnisch-russischen Stetl die religiöse Schule, den Cheder, und kam mit sechs Jahren ohne ein Wort Englisch in die USA. Sein Vater Abraham, ein Schneider, war von der russischen Armee desertiert und schon einige Jahre zuvor emigriert. Dann hatte er die Familie nachgeholt. Zunächst wohnten die Rickovers, wie sie sich jetzt nannten, in Manhattan, dann zog der Vater wieder voraus nach Chicago und ließ die Family nachfolgen. Er sollte dort zwar später ins mittlere Management aufsteigen, zunächst lebte man aber weiterhin in sehr angespannten Verhältnissen. Hyman musste schon als Kind zum Familieneinkommen beitragen, erst als Lagerhelfer in einer Greißlerei, später als Telegrammbote für Western Union – per Fahrrad oder Straßenbahn. Das machte er dann sogar als Vollzeitangestellter, freilich am Nachmittag und am Abend, damit er am Vormittag die Highschool besuchen konnte. Sein Traum war die Marineakademie in Annapolis, damals fest in der Hand der alten Eliten. Durch eine Intervention eines lokalen Chicagoer Abgeordneten durfte er die Aufnahmsprüfung ablegen und schaffte sie knapp. In der Akademie gab es damals gerade einmal 17 Juden unter den fast 1.000 Kadetten. Antisemitismus war üblich, weniger unter den Lehrern denn unter den Mitschülern, die Juden wurden sozial isoliert, manchmal auch verächtlich gemacht. Doch Hyman biss sich durch und schloss als 107. einer Klasse von 540 jungen Offizieren ab. Rickover heiratete zwei Mal, jedesmal Christinnen, konvertierte aber selbst nicht, auch wenn ihn Religion – anders als Literatur und Philosophie – nicht besonders interessierte. Seine Wurzeln dürfte er aber nie vergessen haben. An seinem Sterbebett, als er schon nicht mehr selbst lesen konnte, las ihm seine zweite Frau aus einem Buch vor, das sich mit dem polnischen Stetl und der Shoah beschäftigte.
























