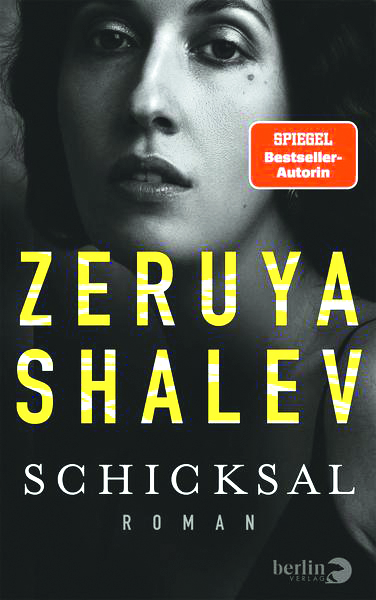Vom „Gründerhügel“ aus, in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland, blickt Rachel hinab in die Wüste und zurück auf ihr Leben. In den 1970er-Jahren ist sie mit ihrer Familie und einigen wenigen Gleichgesinnten hoffnungsfroh hierhergezogen, nun wohnen hier viele Tausende und müssen immer noch mit „gezogenen Waffen“ bewacht werden. Nein, so hat sich die Neunzigjährige ihr Leben nicht vorgestellt. Dem Kampf um das Land, dem Kampf gegen die britische Mandatsmacht in Palästina, hat sie in ihrer Jugend fast alles geopfert, nun ist Rachel eine der letzten Zeuginnen, die von der Untergrundorganisation Lechi berichten kann. Von ihren toten Helden, ihren spektakulären Aktionen und ihrem Scheitern. Denn im Gegensatz zur vielgerühmten Haganah wurde die Rolle der Lechi, die als Terrororganisation nach der Staatsgründung Israels 1948 sogar verboten wurde, lange verschwiegen. Und auch Rachel wird nicht mehr zugehört. Bis sich eines Tages eine viel jüngere Frau, Atara, für ihre Geschichte interessiert. Aus sehr persönlichen Gründen. Denn Rachel war, wie Atara nach dem Tod ihres Vaters, des Hirnforschers Meno Rubin, herausfindet, dessen erste Frau. Nur ein Jahr dauerte die „unreife Ehe“ der beiden zwanzigjährigen Untergrundkämpfer, beide gründeten danach eigene Familien und trafen einander nie wieder. Und doch hat sie ihr Vater, unter dessen grausamer Kälte sie als Kind so gelitten hatte, dass sie seinen Tod herbeisehnte, auf seinem Sterbebett ungewohnt zärtlich Rachel genannt.
Schuld ohne Sühne. „Es gibt kein Vorher und Nachher in der Tora“, hat Meno die kleine Atara einmal belehrt, und dieser talmudische Grundsatz könnte auch als Motto über Zeruya Shalevs Roman stehen. Vorher und Nachher, Vergangenheit und Gegenwart scheinen in der Geschichte der beiden Frauen genauso wie in der Geschichte Israels schicksalhaft miteinander verknüpft. Als Architektin hat sich Atara bezeichnenderweise auf die sensible Restaurierung alter Gebäude spezialisiert. Ihre erste Begegnung mit Rachel wird durch deren Sohn gestört, der ein ultraorthodoxer Kabbalist geworden ist. Mit ihrem zweiten Besuch macht sich Atara unschuldig schuldig am plötzlichen Tod ihres Ehemannes Alex, eine Erkenntnis, die sie besonders im Gefolge der Schiva, der Trauerwoche mit ihren vielen ungebetenen Gästen, zu Boden wirft. Szenen ihrer spannungsreichen zweiten Ehe mit Alex, für die beide ihre ersten Familien verließen, Schuldgefühle den erwachsenen Kindern gegenüber, Unsühnbares und Ungesühntes verdunkeln Ataras Bewusstsein. Über viele Dutzende Seiten seziert Shalev die umwölkte Psyche der zur Witwe gewordenen Frau, quälend auch für den empathischen Leser.
»Verhängnisvolle Familiendramatik,
das kann Shalev eben am besten.«
An den eigenen Ansprüchen, den eigenen Erwartungen scheitern Partner, scheitern Eltern, scheitern Idealisten. Und selbst das Schuldgefühl ist eine Hybris, eine „Unglück bringende Überheblichkeit“. Zeichenhaft blitzt immer wieder das Bild des biblischen Sündenbocks auf.
Verhängnisvolle Familiendramatik, das
kann Shalev eben am besten. Und so universal, so allgemein menschlich Beziehungen, Verfehlungen und Konflikte auch sind: Shalevs Szenarien spielen immer vor der unverwechselbaren Kulisse Israels. Diesmal kommt dem Land selbst aber eine wesentliche Rolle zu. Auch ihr eigener Vater, so die Autorin in einem Interview, war in seiner Jugend kurze Zeit Kämpfer in der Lechi gewesen. Zeit seines Lebens wollte sie seine Erzählungen nicht hören, nach seinem Tod jedoch begann sie die Geschichte zu faszinieren, und sie begann zu recherchieren. Rachel ist ihr Sprachrohr für die Heldensaga der mutigen Pioniere geworden. Sie, die alte unentwegte Idealistin, muss das Pathos nicht scheuen, wenn sie wie ein Mantra immer wieder die Namen der jungen Opfer vor sich hersagt, wenn sie daran erinnert, mit welch hohem Blutzoll Israels Freiheit erkämpft wurde. Ein Pathos, das zumindest in der deutschen Übersetzung oft seltsam archaisch anmutet.
Aber Schicksal ist nicht nur Shalevs bisher israelischster Roman, er ist auch ihr jüdischster. Und da kann die studierte Bibelwissenschaftlerin aus dem Vollen der heiligen Schriften, Gebetstexte und Rituale schöpfen. Wodurch wird „Tikkun“, die „Reparatur“ der Welt, die Verbesserung des Landes, die Erlösung der Menschen erreicht? Shalevs Figuren sind Suchende, ihre Wege sind verschieden. „Gott?! Seit wann ist Gott ein Teil unseres Lebens? Unserer Familie?“, schleudert Atara entsetzt ihrem Sohn Eden entgegen, dem Elitesoldaten, der sich plötzlich der Orthodoxie zuwenden will.
Er ist nur ein Teil des Spektrums der israelischen Gesellschaft, das Zeruya Shalev in ihrem breit angelegten Erzählpanorama altmeisterlich entfaltet. Wie bei einem guten Bild kann darin jede und jeder seine Sicht darauf einbringen, andere Geschichten aus diesem vieldeutigen Buch herauslesen.