Nora Sternfeld arbeitete zwei Jahre im Rahmen eines Vermittlungsprojekts mit Wiener Jugendlichen zum Holocaust. Im Gespräch mit WINA erzählt sie, warum sie diese Vermittlung als politische Arbeit sieht, mit der man nicht aufhören darf.
WINA: Wenn man heute von Aufklärung über die NS-Zeit an Schulen spricht, nennt man das „Holocaust Education“. Ist das nur ein anderer Begriff für Vergangenheitsbewältigung?
Nora Sternfeld: Holocaust Education, man hört es schon: Das ist ein englischer Begriff, der sich im deutschsprachigen Raum noch nicht so lange etabliert hat. Er kommt aus den USA und ist mit einer Moral- und Werterziehung verbunden. In Ansätzen der Geschichtsvermittlung, die sich vor dem Hintergrund der Frankfurter Schule im deutschsprachigen Raum entwickelt haben, geht es um mehr historische Methoden und die konkrete Auseinandersetzung mit spezifischen Orten, Quellen, Kontinuitäten. In der Holocaust Education werden die historischen Mittel demgegenüber oft als viel weniger wichtig betrachtet als die Frage nach den heutigen Werten und danach, was getan werden kann. Man kann auch sagen: Es gibt zwei Seiten jeder Geschichtsvermittlung – die Auseinandersetzung mit dem, was geschehen ist, und jene damit, was das für die Gegenwart bedeutet. Ich denke, beide sind gleich wichtig, und ich kann mich dem, was passiert ist, nur mit historischen Mitteln zuwenden.
Wann hat man sich auch in Österreich eher diesem ethisch-moralischen Ansatz zugewendet?
❙ Ich würde sagen, das ist erst in den letzten 15 Jahren passiert.
Davor gab es einfach nur eine Vermittlung dessen, was in der NS-Zeit passiert ist?
❙ Ja und nein. Davor war es einfach anders umkämpft. Es galt, die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis überhaupt erst zu erringen. Da gab es die Fraktionen, die nicht darüber reden wollten, und die Fraktionen, die erinnern wollten. Das heißt, die einen wollten einen Schlussstrich ziehen, die anderen kämpften um ein „Niemals-Vergessen“. Und diese Positionen gab es auch unter den Lehrenden, und so drückte sich das dann auch widersprüchlich im Unterricht aus. Und auch die AutorInnen der Schulbücher waren AnhängerInnen der einen oder anderen Fraktion. Das kann man aus den Büchern auch herauslesen und herausanalysieren.
„Es gibt zwei Seiten jeder Geschichtsvermittlung – die Auseinandersetzung mit dem, was geschehen ist, und jene damit, was das für die Gegenwart bedeutet.“
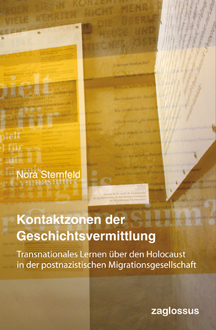
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung. Transnationales Lernen
über den Holocaust
in der postnazistischen
Migrationsgesellschaft.
zaglossus Verlag,
260 S., € 19,95
Heute gibt es aber, wie in Deutschland schon länger, auch in Österreich eine Selbstverständlichkeit, sich in der Schule mit der Zeit der Nazis auseinanderzusetzen. Das ist auch eine Errungenschaft von Kämpfen, die lange nur von Überlebenden geführt wurden. Und zugleich ist es heute auch Teil einer europäischen Politik von oben. Und dann kam es eben zu einer anderen Dimension: der Hereinnahme einer Moral- und Werteerziehung. Wobei diese wieder unterschiedliche Funktionen hat – in den USA ist es vor allem etwas sehr Engagiertes, bei dem man sich ein schreckliches Beispiel wählt, wo die USA aber nicht schlecht dastehen, um über heutige Probleme, wie zum Beispiel Rassismus, zu sprechen.
In Israel wiederum geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie man in einer Gesellschaft, in der viele Menschen Überlebende sind und die sich als wehrhaft versteht, daraus auch etwas Identitätsstiftendes zieht. Und ich finde es sehr gut und wichtig und notwendig, dass Menschen, die in Österreich unterrichten, sagen, „wir wollen schauen, wie andere das in anderen Ländern machen“, und dass sie einander treffen und miteinander reden und sich auch herausfordern lassen.
Dieser Austausch findet erst seit Kurzem statt?
❙ Den hat es vielleicht vorher auch schon gegeben, dennoch halte ich es nicht für Zufall, dass heute zunehmend von Holocaust Education gesprochen wird.
Man nennt das jetzt so.
❙ Ja, und das ist doch interessant, dass man es so nennt. Beide Worte bezeichnen die Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die hier geschahen oder von hier ausgingen, mit Begriffen von anderswo: „Holocaust“ und „Education“ – das muss ja von woher kommen – auch der Begriff „Holocaust“ ist überhaupt erst aus den USA nach Europa gekommen, durch eine TV-Serie. Das hat sich dann eingebürgert und institutionalisiert. Mir geht es sicherlich nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern sich einfach anzusehen: Mit welchen jeweiligen Hintergründen, mit welchen jeweiligen Beziehungen und Zusammenhängen sind diese Dinge verbunden, und was davon finden wir heute eigentlich wirklich gut und wichtig.
Heute hat man das Gefühl, dass kein junger Mensch, der die Schule verlässt, sich nicht in irgendeiner Form mit der NS-Zeit befasst hat.
❙ Und dabei kommen die verschiedensten Strömungen zur Anwendung. Es gibt ja nicht nur die Holocaust Education. Eine andere Strömung, die man als selbstreflexiven Zugang zur Geschichte bezeichnen könnte, kommt eher aus der deutschen Geschichtsdidaktik und vor allem aus der Gedenkstättenpädagogik. Das ist ein Zugang, der sagt, es führt kein Weg an der Auseinandersetzung mit Geschichte vorbei, dabei müssen wir uns die Fakten ansehen und mit einer Selbstreflexion unseres eigenen Blickes darauf verbinden. Gerade von diesem Ansatz habe ich bei unserem Projekt sehr viel gelernt.
Welcher Vermittlungsweg ist in Österreich dominant?
❙ Ich denke, jeder Lehrer, jede Lehrerin steht vor der schwierigen Frage, wie unterrichte ich heute, und findet seinen bzw. ihren eigenen Weg. Klassischerweise wird dabei nicht alles so auseinandergenommen, wie wir das in unserem Projekt und Buch gemacht haben. Aber die Leute spüren ja die Widersprüche, und die meisten LehrerInnen sind extrem engagiert und wollen auch ihren eigenen Weg finden. Was ich allerdings sehr schade finde, ist, dass nicht viele migrantische LehrerInnen im Geschichtsunterricht und in der Gedenkstättenvermittlung tätig sind. Es wird immer schwierig sein, aus der monoperspektivischen Erzählung herauszukommen, wenn etwa Roma-Positionen oder MigrantInnen als VermittlerInnen ausgeschlossen bleiben.
Was ist an heimischen Schulen im Bereich der Vermittlung der NS-Zeit gut gelungen?
❙ Erinnern.at macht extrem wichtige Arbeit. Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass das Thema wichtig und notwendig ist. Das war nicht immer so, und es gibt immer noch viele Orte, an denen das überhaupt erst errungen werden muss. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die FPÖ eine sehr große Anzahl von WählerInnen findet und dadurch eine große Anzahl von Möglichkeiten zur Einflussnahme hat, und insofern ist diese Selbstverständlichkeit eine Errungenschaft, die aber andererseits immer wieder errungen werden muss. Und da kann man sich nur bei allen bedanken und hoffen, dass sie weitermachen.
Was ist noch nicht erreicht worden?
❙ Sich der Schwierigkeit zu stellen, was es heißt, demokratischer an das Thema heranzugehen, zu hören, was Leute eigentlich interessiert, und dann zu sehen und aus einer Diskussion darüber herauszulesen, wie diese Interessen eben doch auch problematisch sein können. Das birgt Gefahren, und logischerweise haben da viele Leute Angst. Das in einen Schulalltag zu integrieren, ist extrem heikel. Daher bräuchte es hier viel mehr Schulungen für Lehrende, damit diese eine Sicherheit darin erringen, offener an das Thema heranzugehen, ohne sich in der Diskussion auf die rechte Seite hinüberziehen zu lassen.
Das impliziert, dass manche Jugendliche den Unterricht über die NS-Zeit dazu missbrauchen, um Rassismus oder Rechtsextremismus in die Debatte mit einzubringen?
❙ Ja. Oder auch Antisemitismus. Was natürlich vorkommt, wenn das Thema offen diskutiert wird. Aber ich bin überzeugt, dass, wenn das nicht so auf die Tagesordnung kommt, diese Dinge trotzdem existieren, und es daher auch Aufgabe der Schule ist, Situationen zu schaffen, in denen das ausgehandelt werden kann, ohne dabei etwas zu legitimieren. Ja, das ist extrem schwierig, und es sind auch viele Lehrende an uns herangetreten und haben gesagt, „wir verstehen, was ihr da sagt, aber dafür brauchen wir einen passenden Raum, dafür brauchen wir eine Ausbildung.“ Was darüber hinaus fehlt: Wir leben in einer stark heterogenen Gesellschaft, und da kommt es zu parallelen Geschichtserzählungen. Nehmen wir zum Beispiel Jugendliche, deren Familien aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien kommen. Aber es gibt auch viele Roma an Österreichs Schulen. Diese anderen Perspektiven sind im Schulunterricht noch nicht angekommen.
„Es gibt zwei Seiten jeder Geschichtsvermittlung – die Auseinandersetzung mit dem, was geschehen ist, und jene damit, was das für die Gegenwart bedeutet.“
Man spricht also über die Ermordung der Juden, aber nicht über die Verfolgung der Roma und Sinti?
❙ Ja, genau.
Rechtsextremismus, Nationalismus, Antisemitismus: Mit alldem ist die Gesellschaft, und damit auch die Schule, weiterhin konfrontiert. Man könnte nun auch fragen: Was hat die ganze Aufklärungsarbeit bisher bewirkt – oder eben nicht bewirkt?
❙ Ich glaube ja nicht, dass es das alles immer noch gibt – sondern immer mehr. Und ich glaube, wir haben echt viel zu tun. Und ich denke eben genau nicht, dass es eine Schutzimpfung ist, sondern eine politische Arbeit. Ich habe viel darüber nachgedacht, was „niemals vergessen“ bedeutet. Das ist eine Forderung, die zuerst eigentlich von Überlebenden am Morzinplatz gestellt wurde. Und in diesem Kontext bedeutete das: einerseits erinnern, andererseits sich politisch zu engagieren. Für mich stecken diese beiden Forderungen in den „niemals vergessen“ drinnen. In manchen Zeiten gelingt es uns besser, in dieser Gesellschaft viele zu überzeugen, und in anderen Zeiten ist es dann vielleicht sogar auch möglich, dass die FPÖ bei einer Wahl an erster Stelle landet. Da müssen wir uns umso mehr anstrengen, denn das ist einfach eine Gefahr, und davor fürchte ich mich auch. Daher sehe ich meine Arbeit auch als politisches Engagement, gegen die FPÖ, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und Rassismus anzutreten.
Gehen wir kurz zurück zu den Roma und Sinti. Diese NS-Opfergruppe beziehungsweise deren Nachkommen kämpften Jahrzehnte, bis sie anerkannt waren.
❙ Sie kämpfen bis heute und sind bis jetzt massiver rassistischer Diskriminierung bis hin zu Anschlägen ausgesetzt. Ich finde es extrem wichtig, dieses Thema aufzugreifen und ihm genauso viel Raum zu geben wie den anderen Themen in diesem Zusammenhang. Das muss auch im Schulunterricht mehr Raum bekommen. Aber bislang ist das noch nicht der Fall.
Migrantische Jugendliche – auch sie sind keine homogene Gruppe, sondern haben unterschiedlichste Herkunftsländer.
❙ Sie sind total unterschiedlich – und teilweise auch sehr involviert, wie zum Beispiel Jugendliche mit serbischem Background. In Serbien hat es massive Verbrechen gegeben, und es würde sich gehören, auch im Schulunterricht offenzulegen, dass die Nazis dort Menschen umgebracht haben. Dann gibt es auch weniger Involvierte, wobei die Frage ist, wenn wir von einem Weltkrieg sprechen, ob es wirklich nicht Involvierte gibt, da bin ich mir eben nicht sicher. Es gibt jedenfalls unterschiedliche Formen der Perspektive, was die NS-Zeit betrifft. Und der Unterricht darf nicht weiterhin homogener sein als das Klassenzimmer, in dem er stattfindet. Wir können ganz anders über diese Zeit reden und auch noch sehr viel lernen, wenn man das hineinnimmt, was in den Herkunftsländern von MigrantInnen passiert ist – und auch welche Rückbezüge es da gibt.
Nehmen wir einmal die Situation in Palästina – die ist ja überhaupt nicht so eindeutig. Es gibt eine klare Allianz zwischen dem Mufti von Jerusalem und den Nazis. Es gibt auf der anderen Seite auch Allianzen zwischen arabischen und jüdischen Leuten dort. Sich so etwas genauer anzusehen, macht es auf eine interessante Weise kompliziert, und sich Dinge genau anzusehen, bedeutet auch, dass nicht mehr so schematisch über Geschichte gesprochen wird. Ein anderes Beispiel: Am Tag der Befreiung feierten algerische KämpferInnen der französischen Armee, die gegen die Nazis gekämpft hatten, bei den Befreiungsfeierlichkeiten mit – und wurden bei einem Massaker umgebracht, weil sie die algerische Flagge trugen. Hier haben wir dann ein doppeltes Befreiungsthema. Sich diese Komplikationen anzusehen, bedeutet einfach, dass die Sachen nicht so einfach sind. Damit ermöglicht man aber auch unterschiedliche neue Solidaritäten. Da sind wir auf der Seite, auf der wir uns ansehen, was genau passiert ist. Deshalb finde ich es so wichtig, sich der Geschichte genau zu stellen. Und sich dann alle Bezüge anzusehen. Und da gilt es dann eben, Ressentiments zu thematisieren und viele Debatten zu führen, bei denen auch Antisemitismus zum Thema werden kann. Dazu müssen unsere Institutionen aber überhaupt erst einmal auf die Höhe an Internationalität kommen, in der die Gesellschaft längst ist.
Manche Jugendliche mit Migrationshintergrund bringen selbst Flucht- und Verfolgungsgeschichten mit, sind von Traumatisierung betroffen. Andere bringen Antisemitismus mit.
❙ Oder lernen ihn hier.
Wieder andere sehen sich auch in Österreich Rassismus ausgesetzt. Wie spielt das alles in einen Unterricht über die NS-Zeit hinein?
❙ Ich will vor allem nicht die MigrantInnen in einem Topf und die ÖsterreicherInnen in einem anderen Topf sehen. Sie sind alle unterschiedlich, und schon in diesen Töpfen sehe ich ein großes Problem. Es ist wichtig, sich zu überlegen, was man dann in einer Situation macht, wenn solche Dinge an die Oberfläche kommen. Das braucht sehr viel Kraft und Empathie und Auseinandersetzung, die jeweils sehr spezifisch ist. Man muss sich die Zeit nehmen, sich intensiv darauf vorbereiten und sich mit anderen Leuten austauschen. Genau das würde ich fordern: dass Lehrende hier mehr Möglichkeiten haben, sich schulen zu lassen.
Das heißt, es reicht nicht, einmal im Leben zu einem Lehrerseminar nach Yad Vashem zu fahren – was ja grundsätzlich schon sehr viel ist.
❙ Gerade in Yad Vashem wird das ja nicht thematisiert. Das ist das, was ich meine. Was wir brauchen, ist eine Auseinandersetzung damit, wie wir die vielen komplizierten Widersprüche offen und radikal demokratisch diskutieren können und am Ende dennoch eine antifaschistische Auseinandersetzung daraus wird.
Wer hätte die Expertise, solche Schulungen anzubieten?
❙ Es gibt viele migrantische PädagogInnen, die sich extrem viele Gedanken darüber gemacht haben, die gegen Antisemitismus arbeiten, gegen Rassismus, die sich sowohl mit Geschichte auseinandersetzen als auch mit den aktuellen Bezügen. Leider bekommen die meisten Jobs in diesem Bereich, eigentlich fast alle, immer nur MehrheitsösterreicherInnen. Hier geht es schon auch um eine Öffnung.
PädagogInnen mit Migrationshintergrund sind aber grundsätzlich immer noch in der Minderzahl.
❙ Absolut – und sie werden marginalisiert. Sie haben viel weniger sichere Positionen und weniger Möglichkeiten, gerade im Bereich Geschichte.
Unterm Strich bedeutet das aber vor allem: Man muss in einer Migrationsgesellschaft mit anderen Ansätzen arbeiten als in einer homogenen.
❙ Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass das, was wir für eine Pädagogik der Öffnung und eine Pädagogik der Werte und Moral halten, auch eine sein kann, die Einschlüsse und Ausschlüsse reproduziert, die in der Gesellschaft schon passieren. Davor ist auch die Erinnerungsarbeit nicht gefeit. Und dagegen müssen wir arbeiten.
Man kann aber eben auch nicht plakativ sagen, dass es nun die Zuwandererkinder sind, die wieder Antisemitismus in unsere Gesellschaft bringen.
❙ Ich habe dieses Buch auch geschrieben, um zu sagen: Es gibt nicht mehr Antisemitismus unter MigrantInnen als unter ÖsterreicherInnen. Der Antisemitismus unter FPÖ-WählerInnen existiert tatsächlich.
Es ist aber aktuell ein sehr gängiges Bild, auch in der jüdischen Gemeinde, dass der steigende Antisemitismus von islamischer Seite kommt.
❙ Die Jugendlichen, die in unserem Projekt Werbung für Rechtsextremismus machen wollten, waren ÖsterreicherInnen. Was den Antisemitismus von muslimischer Seite anbelangt, war das Interessante, dass das zu einer sehr komischen Situation geführt hat: Ich habe gelernt, dem Antisemitismus von rechts etwas entgegenzuhalten. Ich hatte aber Angst davor, dass ich rassistisch reagiere, wenn er von muslimischer Seite kommt. Dass ich mich wehre, aber nicht adäquat. Und deswegen habe ich ihn verhindert, ich habe aus Angst vor meinem eigenen Rassismus verhindert, dass er herauskommt. Darüber habe ich noch viel nachgedacht. Wir brauchen diese Auseinandersetzung in einer Atmosphäre des Vertrauens, aber mit klaren Linien. Und selbst dann erreichen wir wahrscheinlich nicht alle, weder alle MigrantInnen noch alle ÖsterreicherInnen. Es ist eben keine Schutzimpfung. Aber das Ziel macht immer weiter Sinn: das antifaschistische Einverständnis zu vergrößern.
Nora Sternfeld, geb. 1976 in Wien, Philosophiestudium an der Universität Wien, Doktorat in Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Ausstellungstheorie und -praxis, Bildung, zeitgenössische Kunst, Geschichtspolitik und Antirassismus. Derzeit ist Sternfeld Professorin für „Curating and Mediating Art“ an der Aalto University in Helsinki und im Leitungsteam des ecm-Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie und -praxis an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Sie ist zudem Teil des Wiener Büros trafo.K, das an Forschungs- und Vermittlungsprojekten an der Schnittstelle von Bildung, Kunst und kritischer Wissensproduktion arbeitet. trafo.K bereitet aktuell eine Ausstellung zu den 1970er-Jahren auf der Schallaburg vor, die im März 2016 eröffnen wird. Gleichzeitig ist sie Kuratorin bei der Bergen Assembly 2016.
trafo-k.at | en.bergenassembly.no
Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung
Das Büro trafo.K arbeitete im Rahmen eines Forschungs- und Vermittlungsprojekts mit Schülern des Brigittenauer Gymnasiums zum Thema Holocaust. Ausgangspunkt war die Frage „Und was hat das mit mir zu tun?“, von der ausgehend sich die Jugendlichen ihr jeweils individuelles Thema mit Bezug zur NS-Zeit erarbeiteten. Unterstützt wurden sie dabei von Experten verschiedenster Disziplinen – von Historikern bis zum Rechtsextremismusexperten.
Mit dem Buch Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung hat Nora Sternfeld einen Wegweiser vorgelegt, wie die NS-Zeit in unserer heutigen Migrationsgesellschaft vermittelt werden könnte. Sie führt in die relevante Literatur ein, reflektiert Erfahrungen, legt aber auch Schwachpunkte offen, die sich im Zuge dieser Arbeit ergeben hätten: etwa, dass im Projektteam zu wenige migrantische und Roma-Positionen vertreten gewesen seien. Andererseits musste sie feststellen, dass sich Schüler darauf verstehen, politisch korrekt zu sprechen, sodass es zu keiner richtigen Auseinandersetzung kommt trotz zum Beispiel persönlicher antisemitischer Haltungen.
Fazit: Es geht darum, das richtige Setting anzubieten. Dazu braucht es aber entsprechend gut geschulte Lehrende – die auch mehr als derzeit, idealerweise selbst, Migrationshintergrund haben sollten.
Bild: © Daniel Shaked













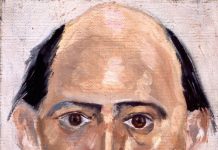
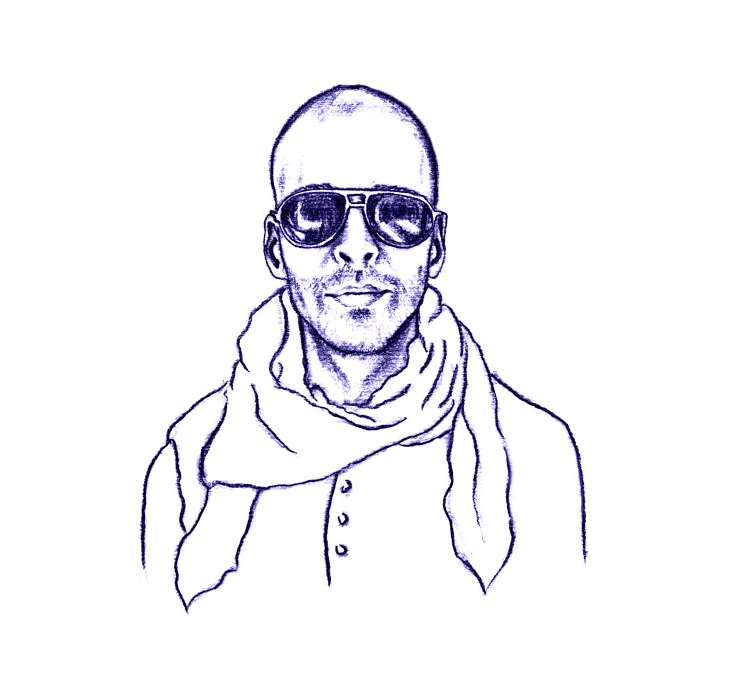
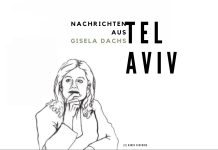




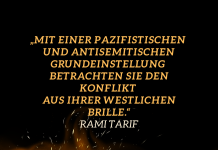

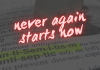




Nora Sternfeld am 15.11.2015 in Wina auf die Frage:
Es ist aber aktuell ein sehr gängiges Bild, auch in der jüdischen Gemeinde, dass der steigende Antisemitismus von islamischer Seite kommt.
❙ Sternfeld: „Die Jugendlichen, die in unserem Projekt Werbung für Rechtsextremismus machen wollten, waren ÖsterreicherInnen. Was den Antisemitismus von muslimischer Seite anbelangt, war das Interessante, dass das zu einer sehr komischen Situation geführt hat: Ich habe gelernt, dem Antisemitismus von rechts etwas entgegenzuhalten. Ich hatte aber Angst davor, dass ich rassistisch reagiere, wenn er von muslimischer Seite kommt. Dass ich mich wehre, aber nicht adäquat. Und deswegen habe ich ihn verhindert, ich habe aus Angst vor meinem eigenen Rassismus verhindert, dass er herauskommt. Darüber habe ich noch viel nachgedacht. Wir brauchen diese Auseinandersetzung in einer Atmosphäre des Vertrauens, aber mit klaren Linien. Und selbst dann erreichen wir wahrscheinlich nicht alle, weder alle MigrantInnen noch alle ÖsterreicherInnen. Es ist eben keine Schutzimpfung. Aber das Ziel macht immer weiter Sinn: das antifaschistische Einverständnis zu vergrößern.“
(Slowthrop meint: Genau darauf kommt es in Zukunft jedoch an, auf antisemitische und rassistische Einstellungen, die von der muslimischen Seite her kommen, adäquat zu reagieren. Dafür gibt es, so weit ich das überblicke, noch keine praktischen Ansätze.)
Für Erfahrungen und Tipps in dieser Frage bin ich immer dankbar.