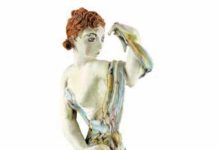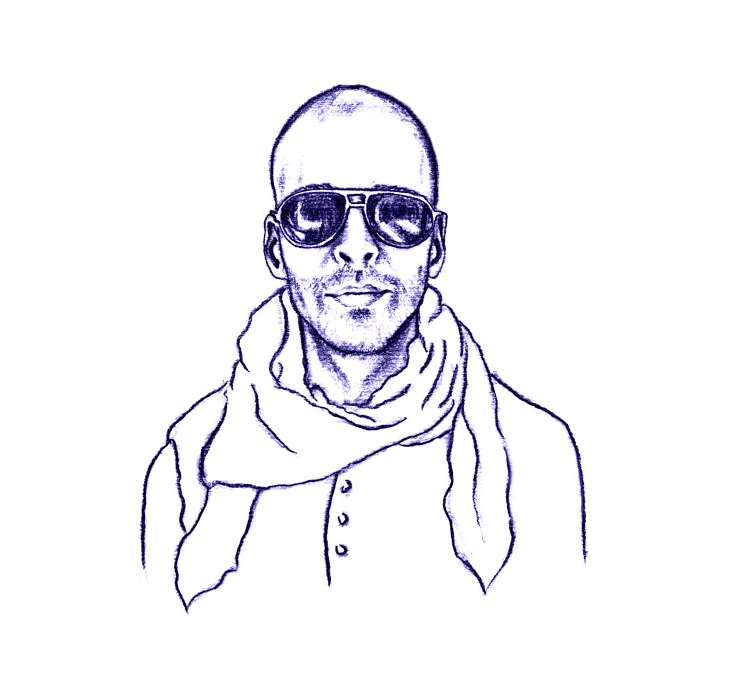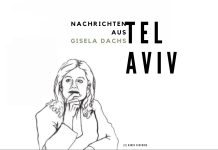Nach der Vertreibung und Jahrzehnten einer unmöglichen, gerade eben geduldeten Ausnahmeexistenz zeichnet sich erstmals ein Aufschwung in der Gemeinde ab, die sich verjüngt und durch neue Impulse von außen das Judentum in Wien erblühen lässt. Die Erfolgsgeschichte der IKG Wien – heute wie vor 200 Jahren. Eine Serie von Tina Walzer
Die Vertreibung aus den Geschäften, Wohnungen, Häusern und Synagogen, die Verfolgung bis hin zur Ermordung, die zaghafte, abgekapselte, mit Müh und Not geduldete Nachkriegsgemeinde – all das hat sich in der Wiener jüdischen Geschichte bereits drei Mal abgespielt. Die Situation für Juden in Wien nach der zweiten Vertreibung war im 18. Jahrhundert jener der 1950er-, 1960er-Jahre nicht unähnlich. Jedes selbstbewusste öffentliche Auftreten war unerwünscht, Hofjuden waren als Handlanger der Regierenden gerade geduldet und mussten sich ihre Existenzberechtigung immer aufs Neue teuer erkaufen. Mit dem beginnenden Josephinismus, der in Wien mit der Hochblüte der Haskala (der jüdischen Aufklärung) zusammenfiel, erlahmte das Interesse der Jungen an Tradition und Kult zunehmend. Zwei starken Persönlichkeiten ist es zu danken, dass die Wiener Juden schließlich doch, nach jahrzehntelangem Kampf, eine Religionsgemeinschaft begründen und eine Synagoge bauen durften: Isak Löw Hofmann und Michael Lazar Biedermann waren die Architekten der IKG Wien. Die Herausforderung lautete bald: eine große Synagoge, ja, ein Gebäude, schick, nach dem letzten Schrei, aber für wen? Wie die jungen Leute, die Nachkommen der Hofjudenfamilien, für den Ritus interessieren, zur Teilnahme bewegen, damit nicht nur ein paar Alte die Weite des neuen G-tteshauses mehr schlecht als recht belebten?
Wie die jungen Leute für den Ritus interessieren, zur Teilnahme bewegen?
Die Diskussion dauerte mehrere Jahrzehnte an, heftige Auseinandersetzungen wurden geführt. Die Traditionsstürmer aus dem fernen Hamburg und Berlin machten sich daran, Wien zur Gänze zu erobern, doch die traditionsbewussten Neuzuwanderer aus Ungarn, Böhmen und Mähren schafften schließlich einen Ausgleich der Interessen: Der Wiener Ritus entstand, ein typisches Produkt dieser Stadt, ein Kompromiss – ein bisschen Reform, aber nicht zu viel. Das berühmte Zweigestirn der Wiener Gemeinde, der Oberrabbiner Isak Noah Mannheimer und sein Oberkantor Salomon Sulzer, ein weltberühmter Musiker und Komponist, setzten die Vorgaben bravourös um und schafften es, den Josef Kornhäusel’schen Stadttempel mit Alt und Jung bis auf den letzten Platz zu füllen. Dass daneben nicht nur eine unabhängige sefardische Gruppe, die Türkisch-Israelitische Kultusgemeinde, sondern auch gleich im Nachbarhaus eine orthodoxe Gemeinde existierten, rundet das Bild der IKG Wien ab – und allzu viel hat sich, wenn man es recht bedenkt, bis heute nicht wirklich daran geändert.
1811 wurde das Grundstück für die zukünftige Synagoge im Namen der Wiener Judenschaft gekauft.
Isak Löw Hofmann, Edler von Hofmannsthal, der Urgroßvater des Schriftstellers Hugo von Hofmannsthal (Jedermann), kam 1759 im böhmischen Prostibor als Kind armer Eltern zur Welt. Der Vater starb bald, das Waisenkind wurde in der Prager Gemeinde aufgenommen und dort erzogen. Es spricht für das soziale Engagement und das geistige Niveau der Prager Juden, dass diese Zuwendung ausreichte, um dem jungen Mann eine Stelle als Hauslehrer zu ermöglichen. Sein Chef, hochzufrieden, machte den ausgebildeten Rabbiner schließlich zum Geschäftsführer der Wiener Niederlassung, verheiratete ihn an seine Enkeltochter und bedachte ihn mit einem großzügigen Erbe. Bereits 1789 konnte der 30-jährige Isak Löw Hofmann die Toleranz (Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) für sich in Wien erringen und stieg in den folgenden Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Unternehmer als Seidenfabrikant in Ungarn sowie an der Militärgrenze und darüber hinaus zu einem der Gründerväter der IKG Wien auf. Er starb bald nach der bürgerlichen Revolution, 1849. Der berühmte Gelehrte Bernhard Wachstein lobt seine ausgleichenden Charaktereigenschaften: „Er blieb lebenslänglich der redliche, honorige, für jüdische und allgemein menschliche Interessen empfängliche Mensch.“ Hofmannsthals Geschichte gleicht jener legendären – vom Tellerwäscher zum Millionär.
 Michael Lazar Biedermann (1769–1843), der Begründer des gleichnamigen Bankhauses, stammte aus Preßburg (heute Bratislava, Slowakei), der berühmten, sehr frommen jüdischen Gemeinde. Als armer Graveurlehring kam er nach Wien, arbeitete sich hoch und wurde bald zum Hofkammerjuwelier ernannt. Dann verlagerte er seine unternehmerische Tätigkeit in die boomende Textilproduktion und konnte schließlich ein eigenes Bankhaus gründen, um Industrieunternehmungen zu finanzieren. 1811 kaufte er gemeinsam mit Hofmannsthal im Namen der Wiener Judenschaft (eine Kultusgemeinde gab es noch nicht) um 90.000 Gulden das Grundstück für den zukünftigen Synagogenbau, den Dempfingerhof auf dem so genannten Katzensteig (der späteren Seitenstettengasse) – ein verwittertes, noch aus dem 16. Jahrhundert stammendes Haus, das bald aufgrund seiner Baufälligkeit abgerissen werden musste. Der Neubau, der heute wieder aufgebaute Stadttempel, wurde 1826 feierlich eingeweiht und bestand bis zur Nacht vom 10. auf den 11. November 1938. 1894 wurde nach dem Stifter des Stadttempels in Wien-Hetzendorf ein Straßenzug benannt, die Biedermanngasse, doch die Grabmonumente der beiden Familien am jüdischen Friedhof Währing sind seit der NS-Zeit zerstört.
Michael Lazar Biedermann (1769–1843), der Begründer des gleichnamigen Bankhauses, stammte aus Preßburg (heute Bratislava, Slowakei), der berühmten, sehr frommen jüdischen Gemeinde. Als armer Graveurlehring kam er nach Wien, arbeitete sich hoch und wurde bald zum Hofkammerjuwelier ernannt. Dann verlagerte er seine unternehmerische Tätigkeit in die boomende Textilproduktion und konnte schließlich ein eigenes Bankhaus gründen, um Industrieunternehmungen zu finanzieren. 1811 kaufte er gemeinsam mit Hofmannsthal im Namen der Wiener Judenschaft (eine Kultusgemeinde gab es noch nicht) um 90.000 Gulden das Grundstück für den zukünftigen Synagogenbau, den Dempfingerhof auf dem so genannten Katzensteig (der späteren Seitenstettengasse) – ein verwittertes, noch aus dem 16. Jahrhundert stammendes Haus, das bald aufgrund seiner Baufälligkeit abgerissen werden musste. Der Neubau, der heute wieder aufgebaute Stadttempel, wurde 1826 feierlich eingeweiht und bestand bis zur Nacht vom 10. auf den 11. November 1938. 1894 wurde nach dem Stifter des Stadttempels in Wien-Hetzendorf ein Straßenzug benannt, die Biedermanngasse, doch die Grabmonumente der beiden Familien am jüdischen Friedhof Währing sind seit der NS-Zeit zerstört.
Veranstaltungen am jüdischen Friedhof Währing:
Freiwilligentage: 11.5., 6.7., 14.9., 2.11.2014, jeweils 11 bis 16 Uhr
Führungen: 18.5., 25.5.2014
Anmeldung: Grüner Klub im Rathaus (Fr. Karin Binder). Die Areale in der Seegasse, am Döblinger Friedhof u. am Zentralfriedhof sind frei zugänglich.