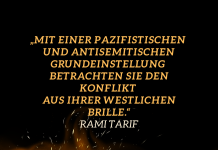Nobelpreisträger Dan Shechtman über die Gründe der zahlreichen Start-up-Erfolge und über Defizite der israelischen Wirtschaft. Interview & Foto: Reinhard Engel
WINA: Herr Professor Shechtman, wir befinden uns hier im Haus der österreichischen Industrie, vor zahlreichen Porträts einst hier erfolgreicher Unternehmensgründer. Heute gilt Israel als das Land der Start-ups. Worauf basiert diese nicht nur im Nahen Osten, sondern im globalen Vergleich äußerst erfolgreiche Entwicklung?
Dan Shechtman: Viele der besten globalen Konzerne betreiben in Israel Entwicklungsfirmen, so genannte „Development Centers“. Ich spreche da von den Intels der Welt – und zahlreichen anderen dieser Spielklasse. Aber das sind nicht nur Entwicklungszentren, das sind vielmehr echte Innovationszentren. Und diese erarbeiten neue Konzepte für die künftige IT-Technologie. Hier entwickelt man sowohl Software als auch Chips, aber meist werden die Chips nicht in Israel produziert.
Mit der Ausnahme von Intel, das ist ja, mit mehreren Fabriken, der größte industrielle Produzent des Landes.
❙ Das stimmt, Intel hat einige Fabriken in Israel, aber die meisten anderen produzieren nicht im Land. Man könnte es eine Art internen „Brain Drain“ nennen, weil so viele gute Köpfe für ausländische Unternehmen arbeiten. Das ist die schlechte Seite der Sache. Aber es gibt auch eine gute Seite: Diese vielen Tausend Frauen und Männer, die in diesen Unternehmen arbeiten, stehen ganz an der Spitze der weltweiten Technologie-Entwicklung. Sie wissen, was in fünf Jahren in der IT-Branche passieren wird. Und wenn sie eine gute Idee haben, verlassen sie ihr Unternehmen und gründen ein Start-up. Das heißt also, dass sie die Produkte der Zukunft entwickeln können.
„Wir Israelis haben keine Angst, zu scheitern. In Europa und noch viel mehr in Asien gilt Scheitern als Schande.“ Dan Shechtman
Das kann aber nicht sämtliche Erfolge erklären.
❙ Natürlich gibt es noch andere Gründe. Einer davon betrifft das Militär. Sie wissen sicher, dass heute die Kriege zunehmend von der Informationstechnologie abhängen. Themen wie Cyber-Kriegsführung haben daher eine ganz entscheidende Bedeutung erlangt. Und es gibt eine große Zahl von Soldaten in Israel, die an dieser Cyber-Kriegsführung arbeiten.
Die Armee rekrutiert ja bereits an den Gymnasien die besten Schüler jedes Jahrgangs für ihre IT-Spezialeinheiten.
❙ So ist es. Auch diese Soldaten sind dann an der Spitze der technologischen Entwicklung. Und die Cyber-Technologien können sowohl militärisch als auch im zivilen Bereich eingesetzt werden. Wenn diese Soldaten das Militär verlassen, gründen sie Start-ups, oft gemeinsam mit ehemaligen Kameraden bestimmter Einheiten. Darüber hinaus gibt es genug Financiers, Risikokapital, nicht zuletzt von ehemaligen Gründern, die ihr Unternehmen um mehrere 100 Millionen Dollar an einen internationalen Konzern verkauft haben.
Und die verjubeln ihr Geld nicht in der Karibik?
❙ Nein, meist nicht. Sie investieren es wieder in neue junge Unternehmen. Sie wollen damit natürlich noch mehr Geld machen. Aber was fast noch wichtiger ist: Sie engagieren sich auch in diesen Start-ups, helfen den Gründern, Fehler zu vermeiden, beraten sie, binden sie in ihre bestehenden Beziehungsnetze ein, und damit geht es noch einmal schneller mit der Unternehmensentwicklung.
„In der Demokratie kann es manchmal zu Diktaturen von Minderheiten kommen.“
Ich möchte Sie nicht nur zur technischen Seite befragen, sondern auch zur Unternehmenskultur, denn die spielt sicherlich in einer derartig modernen Branche eine entscheidende Rolle. Ich darf Ihnen ein Negativbeispiel aus der europäischen Industrie geben, aus einer durchaus erfolgreichen Branche, der Automobilindustrie. Dort sprechen Unternehmensberater von einer Lehm- und Lähmschicht mittlerer Manager. Das heißt, die Unternehmen sind recht hierarchisch und bürokratisch aufgebaut.
❙ Das ist eben in Israel ganz anders. Nicht nur, weil die Firmen jünger sind und allein deshalb noch nicht so bürokratisch. Es geht insgesamt viel informeller zu: Auch ein einfacher Entwicklungsingenieur kann direkt zum Chef gehen, wenn ihm etwas einfällt, er muss sich nicht mühsam über einige Hierarchiestufen hinaufarbeiten, bis er einen Termin bekommt. Übrigens kann auch das mit dem Militär zu tun haben: Denn die beiden Männer hatten eventuell beim letzten Reserveeinsatz umgekehrte Rollen, da hatte der CEO den niedrigeren Rang und mussten den Befehlen des Ingenieurs gehorchen.
Aber fehlende Hierarchie allein kann wohl die grundlegende Innovationsbereitschaft nicht erklären.
❙ Es gibt zwei weitere essenzielle Grundlagen dafür. Das eine ist eine Kultur des Widersprechens, nicht des Gehorchens. Das betrifft nicht nur die Unternehmen, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Es ist nicht ganz einfach, in so einer Gesellschaft zu leben, es lebt sich bequemer unter Braven. Aber so eine Gesellschaft ist sicherlich innovativ. Und der zweite Aspekt betrifft die Möglichkeit des Scheiterns und dass man das riskiert. Wir Israelis haben keine Angst zu scheitern. In Europa und noch viel mehr in Asien gilt Scheitern als Schande. Das ist in Israel nicht so. Man scheitert und probiert es aufs Neue.
In Israel konzentrieren sich die meisten Start-ups im Bereich von Software und IT. Sie selbst kommen von einer technischen Universität, dem Technion in Haifa, und auch von der Fakultät für Materialwissenschaften und Ingenieurswesen. Glauben Sie, dass diese Konzentration der israelischen Firmengründer auf Software auch ein Nachteil sein kann? Anders gefragt: Braucht Israel auch einen produzierenden Sektor?
❙ Sie haben Recht, die meisten Start-ups finden sich im Softwarebereich. Und sie haben auch Recht, wir brauchen mehr als nur diese eine Spezialisierung. Wir müssen auch Güter erzeugen, die man angreifen kann. Die meisten Start-ups tun das nicht, aber es gibt auch solche, etwa im Bereich moderner Medizintechnik. Ich denke da etwa an Untersuchungsmethoden mit niedriger Strahlung und anderes. Auch meine Universität, das Technion, hilft zahlreichen Start-ups in den unieigenen Inkubatoren. Unsere Universitäten kümmern sich auch um die kommerzielle Umsetzung und Vermarktung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Das ist übrigens am erfolgreichsten im Pharmabereich, von dort kommt das große Geld, und mit den Einnahmen von dort kann man wieder andere Gründer mit finanzieren.
Es hat in jüngster Zeit wiederholt Vorwürfe gegeben, die israelische Start-up-Szene habe ein wenig an Dynamik verloren. Teilen Sie diese Ansicht?
❙ Ich denke eigentlich nicht, aber es könnte durchaus sein. Die Wirtschaft läuft niemals nur geradeaus, es ist ein ewiges Auf und Ab. Japan hat gezeigt, dass es seine Dynamik für 20 Jahre verloren hat. Vielleicht hat Israel einmal zwei schwache Monate gehabt. Aber die Zukunft kennen wir natürlich nicht. Wir bringen jedenfalls immer noch sehr gute Köpfe hervor, und auch das Universitätssystem funktioniert gut. Wir leiden allerdings an einer zu geringen Zahl an Interessenten für die wissenschaftlichen und technischen Studienfächer. Und dagegen kämpfe ich auch persönlich an in meinem Land.
Lassen Sie mich noch einmal auf die israelische Wirtschaft insgesamt zurückkommen. Der Hightechsektor ist zwar erfolgreich international aufgestellt und bringt sowohl Devisen als auch Ruhm. Daneben gibt es aber ein ganz anderes Israel, viel tiefer im Nahen Osten zuhause, viel weniger produktiv und in manchen Aspekten sogar rückständig.
❙ Das stimmt, und wir haben daran mit Schuld, wir haben uns in der Vergangenheit selbst Schaden zugefügt. Es liegt schon etwas länger zurück, aber man hat in Israel ganz bewusst die mechanische und handwerkliche Ausbildung zerstört. Es gibt daher einen gewaltigen Mangel an Menschen mit diesen Fähigkeiten, ich meine Menschen, die Maschinen bedienen können. Das müssen wir korrigieren, aber ich bin mir nicht so sicher, dass die Regierung überhaupt schon bemerkt hat, welchen Fehler sie da gemacht hat. Die Schuld daran trifft übrigens nicht die derzeitige Regierung, das liegt Jahre zurück. Aber wir sollten auf jeden Fall wieder gezielt mit dieser Ausbildung beginnen, an der Schnittstelle zwischen technischem Arbeiter und Ingenieur. Wir brauchen Menschen, die CNC-Maschinen betreiben können, und wir brauchen Menschen, die gut schweißen können. An denen mangelt es, aber es gibt erste Privatinitiativen, um das zu ändern.
Welche Rolle spielen in Israel streng religiöse Juden und Araber am Arbeitsmarkt? Kann man nicht in diesen Gruppen neue Interessenten für wissenschaftliche und technische Berufe suchen?
❙ Vor allem bei Religiösen und bei Arabern gibt es große Probleme am Arbeitsmarkt. Wenn sie arbeiten, arbeiten sie oft unter schlechten Bedingungen, vielfach auch schwarz, in der informellen Wirtschaft. Es ist ein Problem, wir haben nicht genug kluge Köpfe, und manche Haredim hätten diese Köpfe, wollen aber nicht im IT-Sektor arbeiten, das gilt übrigens auch für manche Araber. Wenn sie die richtige Ausbildung hätten, würden sie gut bezahlte Jobs finden.
Aber diese Ausbildung haben sie nicht?
❙ In den religiösen Schulen werden nicht einmal die Grundlagen für Mathematik und Wissenschaft gelehrt, ganz bewusst. Es wird fast nur Religion unterrichtet. Die Regierung lässt ihnen das durchgehen, weil man sie in der Koalition braucht. Dagegen kann man kaum etwas machen, und ihre Zahlen nehmen noch zu, in den Grundschulen geht es in Richtung zwanzig Prozent an Kindern, die keine wissenschaftlichen Grundlagen lernen. Das ist ein ganz großes Problem. In der Demokratie kann es manchmal zu Diktaturen von Minderheiten kommen.
Und gäbe es bei den Frauen der streng Religiösen eine Chance, sie für Technik zu begeistern? Viele von Ihnen arbeiten ja.
❙ Ich habe gerade eine Stadt im Süden von Israel besucht und mit dem Bürgermeister gesprochen. Dort hat eine Gruppe streng religiöser Mädchen beim landesweiten Abschlusstest, der hiesigen Matura vergleichbar, 100 Prozent der Punkte erreicht. Das ist natürlich wunderbar, aber dann heiraten sie, bekommen Kinder – und arbeiten nicht mehr. Hier bin ich in Israel sehr kritisch, sage das laut und werde dafür auch kritisiert. Ich meine, wenn jemand seinen Kindern durch die Schulwahl künftige Optionen nimmt, beschädigt er die Zukunft dieses Kindes. Das sollte vom Gesetz ähnlich bestraft werden wie körperliche Züchtigung. Wenn er sein Kind schlägt, wird er auch bestraft.
Und wie sieht es bei den israelischen Arabern aus?
❙ Die Gruppe der Araber ist, was ihre Ausbildung betrifft, klar gespalten. Die christlichen Araber sind sehr erfolgreich, das steht ganz außer Frage. Bei den Muslimen sieht es anders, weit weniger gut aus. Diesem Problem sollte man sich ernsthafter stellen.
Sie haben am Anfang des Gesprächs den „Brain Drain“ erwähnt, zwar nur in Israel gegenüber ausländischen Firmen, aber doch. Wie bewerten Sie die Entwicklung, dass Tausende von jungen Israelis im Ausland leben und arbeiten, zwischen Berlin und Kalifornien. Werden sie alle wieder zurückkommen und ihr dort erworbenes Wissen wieder zurückbringen, oder könnten sie dauerhaft verloren gehen? Etwa weil sie wollen, dass ihre Kinder nicht in einer Region aufwachsen, in der es keine Aussicht auf dauerhaften Frieden gibt.
❙ Es wird da keine allgemeine Regel geben. Manche werden bleiben, und manche werden zurückkommen. Ich erzähle Ihnen von meiner eigenen Familie, und schon da sieht man beide Möglichkeiten. Ich habe vier Kinder, drei von ihnen leben in Kalifornien, im Silicon Valley. Eine Tochter wird nicht mehr zurückkommen, weil sie dort ihre Familie hat. Die beiden anderen werden, denke ich, zurückkommen. Auf jeden Fall einer meiner Söhne, der gerade als Dr. der Physik seine Postdoc-Ausbildung bei einem Nobelpreisträger in Stanford absolviert. Er ist vor einigen Wochen nach Israel gereist und hat an vier Universitäten Lectures gehalten, weil er einen Job sucht: am Technion, am Weizman-Institut, in Tel Aviv und an der Bar Ilan. Eine Woche später hatte er zwei Angebote. Er kommt auf jeden Fall zurück, und seine Frau arbeitet für Intel.
Das heißt, wenn sie nach Israel kommt, kann sie vermutlich bei der dortigen Niederlassung arbeiten?
❙ Als sie gehört haben, dass sie zurückkommen will, haben sie ihr gesagt: „Beeilen Sie sich, wir warten schon auf Sie.“
Spitzenforschung und Kinderfernsehen
Dan Shechtman wurde 1941 im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina geboren. Er studierte Materialwissenschaft am Tech-nion in Haifa und promovierte dort 1972, daneben absolvierte er ein Ingenieurstudium, das er mit einem BSc abschloss. Es folgten Forschungsjahre in den USA, unter anderem an der John Hopkins University. Seit 1975 arbeitet er am Technion, er hält dort den Lehrstuhl für Materialwissenschaften. Mehrere Monate im Jahr unterrichtet er dasselbe Fach an der Iowa State University.
Shechtman erhielt 2011 den Nobelpreis für Physik für seine Erforschung der so genannten Quasi-Kristalle. Dabei geht es um regelmäßige, aber aperiodische Strukturen von Molekülen in bestimmten Metalllegierungen. Diese Entdeckung, die lange im internationalen Wissenschaftsestablishment umstritten war, dient unter anderem dazu, Stähle oder Aluminiumverbindungen mit höherer Härte zu erzeugen, sei es für die Medizintechnik oder für industrielle Anwendungen.
Shechtman ist mit einer Psychologie-Professorin verheiratet, das Paar hat vier Kinder und 11 Enkelkinder. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Shechtman unter anderem Wissenschaftssendungen für Kinder im israelischen Fernsehen und versuchte 2014, erfolglos, für das Amt des israelischen Staatspräsidenten zu kandidieren.