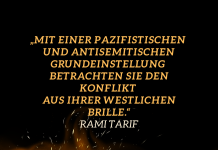Der Budapester Ökonom László Akar zu den Folgen der unorthodoxen Wirtschaftspolitik der ungarischen Regierung und über mögliche Szenarien nach der Wahl. Interview und Foto: Reinhard Engel
wina: Herr Akar, zur gegenwärtigen Lage der ungarischen Wirtschaft gibt es zwei entgegengesetzte Sichtweisen. Die Opposition sagt, die Regierung habe das Wachstum gebremst und Ungarn gegenüber anderen Ländern der Region zurückfallen lassen. Die Regierung verweist auf einen Aufschwung und rühmt sich, für die Bevölkerung bedeutende Erleichterungen erreicht zu haben, etwa günstigere Strom- und Heizkosten. Was stimmt?
László Akar: Man kann nicht leugnen, dass sich die Zahlen verbessern. Aber zugleich können wir keinen wirklichen Aufschwung der ungarischen Wirtschaft erkennen. Die wichtigste Zahl ist das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP), im letzten Jahr 1,2 Prozent. Aber dieses Wachstum kam vor allem aus der Landwirtschaft.
Es gab eine außerordentlich gute Ernte.
Es gab gute Bedingungen, eine sehr gute Ernte. Wenn man das herausrechnet, bleibt kaum Wachstum übrig. Verglichen mit 2011 war das BIP im Vorjahr sogar niedriger. Und wenn man aufs Jahr 2010 zurückgeht, dann betrug das gesamte Wachstum der drei Jahre gerade einmal ein Prozent, viel weniger als Fidesz-Politiker im damaligen Wahlkampf versprochen hatten. Sie hatten damals von drei bis vier Prozent Wachstum gesprochen – pro Jahr.
Ungarn ist keine Insel. Wie vergleicht sich diese Entwicklung mit den Nachbarländern Mittelosteuropas?
Wir sind nicht die Schlechtesten in der Region, denn Slowenien ist durch seine Banken in eine gewaltige Krise gerutscht, und wir liegen vielleicht ein klein wenig besser als die Tschechische Republik. Aber im Vergleich mit den übrigen Ländern, etwa Polen und der Slowakei, schneiden wir schlechter ab.
Was waren die Gründe dafür? Internationale Entwicklungen oder auch hausgemachte Fehler?
Die Haupterklärung dafür ist das schlechte Investitionsklima für Private. Die staatlichen Investitionen sind hingegen deutlich gestiegen.
Mit Hilfe von EU-Fonds.
„Insgesamt hat die rechtliche Unsicherheit und die Unberechenbarkeit der Politik eine Situation geschaffen, in der multinationale Unternehmen keine neuen Investitionen beschließen.“ László Akar
Mit der Hilfe von EU-Fonds. Wenn man diese Zahlungen berechnet, so ergaben sie allein von 2010 bis 2013 zwei Prozentpunkte des BIP.
Die Ungarn sind erfolgreich darin, EU-Gelder zu nutzen.
Das sind sie, und derartige Gelder sollten dann auch zusätzliches Wachstum generieren. Aber aus den zwei Prozent Zuflüssen wurde bloß ein Prozent Wachstum. Ohne diese Gelder hätten wir einen Rückgang gehabt. Die Essenz ist klar: Ohne diese Zuflüsse waren die Investitionszahlen sehr schlecht, mit einer Ausnahme, der Automobilindustrie. Es gab große Investitionen von Konzernen wie Audi oder Mercedes. Doch die Entscheidungen für diese Werke liegen schon länger zurück. Außerhalb dieser Branche sieht man kaum Anzeichen von nennenswerten Investitionen. Landesweit liegen die Investitionen unter den Abschreibungen. Wegen dieser schwachen Investitionen gibt es auch langfristig kaum Chancen für Wachstum.
Sie sprechen dabei nur von ausländischen Unternehmen oder auch von ungarischen?
Ich meine dabei beide Gruppen. Das Problem des Investitionsklimas betrifft Ausländer und Ungarn gleichermaßen. Es hat eine Reihe von Sondersteuern gegeben, etwa für Banken, Handelsfirmen, Energiekonzerne oder Telekom-Anbieter, sogar für Pharma-Firmen. Unternehmer fürchten, dass ähnliche Steuern plötzlich auch anderswo auftauchen könnten. Darüber hinaus fühlen sie Rechtsunsicherheit. Wenn es etwa ein neues Gesetz gibt, kann der Verfassungsgerichtshof dieses nicht mehr verhindern. Man kann vielleicht noch zum Europäischen Gerichtshof gehen.
Aber das dauert Jahre.
Und es ist auch nicht immer möglich. Insgesamt hat die rechtliche Unsicherheit und die Unberechenbarkeit der Politik eine Situation geschaffen, in der multinationale Unternehmen keine neuen Investitionen beschließen. Jene, die da sind, gehen zwar noch nicht weg, aber sie bauen auch nicht groß aus. Bedeutende Investitionen erfolgten in den letzten Jahren in anderen benachbarten Ländern. Wir stehen in Konkurrenz mit Polen, der Slowakei, mit Rumänien und mit Serbien.
Jetzt haben Sie nur von den internationalen Konzernen gesprochen. Warum investieren die ungarischen Unternehmen so wenig?
Die Unsicherheit gilt für sie ebenso. Aber sie sind noch von einer anderen Entwicklung getroffen worden, von der kräftigen Erhöhung des Mindestlohns. Das war eine direkte Folge der Flat Tax.
Können Sie das erklären?
In den meisten Ländern mit einer Flat Tax gibt es eine Steuerbefreiung für Geringverdiener. In Ungarn zahlt man ab dem ersten Forint, den man verdient, 16 Prozent Einkommensteuer. Das hat die Armen am meisten betroffen, sie haben netto weniger verdient. Um diese Verluste auszugleichen, wurde der Mindestlohn erhöht. Das bedeutete, dass ungarische Unternehmen, vor allem kleinere, sich das nicht mehr leisten konnten. Deswegen und wegen der schlechten Inlandsnachfrage haben diese Unternehmen nicht mehr investiert. Manche gingen sogar ins Ausland, etwa in ungarischsprachige Gegenden in der Slowakei, in Rumänien oder in Serbien.
Noch einmal: Wie viele dieser Probleme hängen von der internationalen Entwicklung ab, und wie viele sind hausgemacht durch eine falsche oder erratische ungarische Wirtschaftspolitik?
Natürlich geben die internationalen Entwicklungen die Tendenz vor. Dass der Bankensektor den Verschuldungsgrad abbaut, ist kein ungarisches Phänomen allein. Aber leider haben die Maßnahmen der ungarischen Regierung dies nicht abgeschwächt, sondern sogar verstärkt. Und wenn man diese Bankenentwicklung mit den Nachbarländern der Region vergleicht, war das „Deleveraging“ in Ungarn viel stärker. Die Unsicherheiten im Wirtschaftsklima sind „made in Hungary“. Die Fidesz-Regierung hatte 2010 bei ihrem Amtsantritt keine konkreten Pläne, vielleicht war sie auch einfach zu optimistisch. Sie hat gehofft, dass die EU die hohen Defizite akzeptieren würde. Als sie gesehen hat, dass das nicht geht, hat sie begonnen, besondere Lösungen zu suchen, die so genannte „unorthodoxe Wirtschaftspolitik“ mit Sondersteuern.
Was wären Ihre Empfehlungen für eine Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas?
Ohne einen politischen Wechsel wird es sehr schwer sein, die Einstellung der Akteure zu ändern. Aber vielleicht versucht das sogar Ministerpräsident Viktor Orbán. Vor Kurzem hat er bei einem Frühstück mit EU-Botschaftern gesagt, er sei sehr für die EU, außerdem meinte er, die großen Veränderungen in Ungarn seien bereits geschehen. Probleme mit der EU wie in den letzten Jahren sollten daher künftig nicht mehr entstehen. Darüber hinaus werde es auch in Ungarn zu Konsolidierungen kommen. Zur Lösung der Fremdwährungskredite werde man sich mit den Banken zusammensetzen und Kompromisse finden. Es kann also durchaus sein, dass ein wiedergewählter Orbán seine Politik etwas modifiziert, um die Unsicherheiten zu reduzieren. Aber eine Verbesserung des Wirtschaftsklimas kann sehr lange dauern. Eine bessere Chance, das zu verändern, gäbe es mit einem Regierungswechsel und einem neuen Team, mit neuem professionellen Management, stärker pro-europäisch ausgerichtet. Aber auch unter einem derartigen Szenario wäre das ein langwieriger Prozess. Für gewisse wichtige Veränderungen würde man eine Zweidrittelmehrheit benötigen, überdies sitzen Fidesz-Anhänger an zahlreichen Schlüsselpositionen des Landes.
Was wären also die Alternativen, die Sie sehen?
Für eine mittelfristige Vorschau haben wir bei GKI drei Szenarien entwickelt: Nummer eins bedeutet, dass alles so weitergeht wie bisher. Nummer zwei würde eine gänzlich neue Wirtschaftspolitik einer neuen Regierung bedeuten. Und das dritte, wohl realistischste Szenario hieße etwas zwischen diesen beiden Polen: einige Veränderungen, aber nicht alle, die nötig wären. Dieses Szenario wäre sowohl bei einem Fidesz-Sieg als auch bei einem Regierungswechsel möglich. Aber in der Politik weiß man nie genau, was kommt.
Geschichte des GKI
Die Ursprünge des Wirtschaftsforschungsinstituts GKI reichen in die 1930er-Jahre zurück, während der kommunistischen Reformjahre diente es quasi als zweite Meinung gegenüber den offiziellen – meist zu optimistischen – Prognosen der Regierung, es gehörte damals zum statistischen Amt. 1992 wurde das Institut von der konservativen Regierung unter Ministerpräsident József Antall geschlossen. Die Forscher organisierten ein Weitermachen mit Hilfe breit gestreuter Anteilsbesitzer, heute gehört ein Großteil der Aktien dem Management.
GKI sieht sich als unabhängig, obwohl viele seiner Ökonomen eher der Opposition nahe stehen, Akar diente in einer sozialliberalen Koalition unter Gyula Horn als Staatssekretär. Aber unter den Miniaktionären finden sich auch deklarierte Fidesz-Anhänger. Die wichtigsten Kunden von GKI sind die Europäische Union, für die etwa Konsumentenstudien erstellt werden, sowie internationale Unternehmen wie die Erste Bank Group oder der Spediteur Schenker.