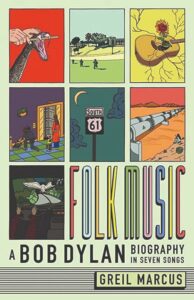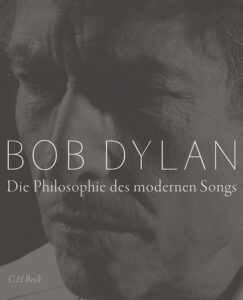Wer hätte das gedacht?! Und doch wieder nicht. Eine Presseagenturmeldung würde lauten: Träger des Nobelpreises für Literatur veröffentlicht ein Buch. So gut, so alltäglich. Im Falle des Musikers und 2016 in Schweden belorbeerten, dauertourenden Sängers Bob Dylan alias Robert Zimmerman ist das schon mehr als Aufsehen erregend. Immerhin ist es das erst dritte Buch des 82-jährigen. Das natürlich von Musik handelt und um Musik kreist.
Es ist aber in einer zweiten Hinsicht ungewöhnlich wie zugleich illuminierend. Denn Bob Dylan, in den letzten 60 Jahren Autor immens vieler, zu Standards gewordener Folk- und Rocksongs, will, so der hochambitionierte Titel, mit diesem schweren, hinreißend schön illustrierten Band nichts Geringeres verfasst haben als eine „Philosophie des modernen Songs“.
Inklusive zahlloser Überraschungen, Entdeckungen und Raritäten. Denn wer hätte gedacht, dass diese Folge von 66 nicht philosophischen Kurzessays über 66 Songs seit den 1940er-Jahren bis 2003 (der vorletzte Song, das punkige London Calling von The Clash, entstand 1979), von denen nur vier von Frauen stammen, im Grunde das Hörverhalten des jungen Bobbie im noch heute abgelegenen Hibbing, Minnesota, wo er aufwuchs, widerspiegelt? Das also, was er als Teenager am Radio hörte? So kommt denn auch – eine der größten Surprisen – Bing Crosby vor. Ebenfalls der crooner Perry Como. Auch Frank Sinatra, dem Dylan vor einigen Jahren eine akustische Hommage zu Füßen legte.
Lieder sind wie Gedanken:
einen Moment lang können sie die heroische Illusion
vermitteln, man könne die Zeit anhalten.
Bob Dylan
Und neben Elvis oder The Who (die Beatles fehlen zur Gänze, dafür ist Cher aufgenommen und Blue Moon von Dean Martin) eine Vielzahl hierzulande kaum bis nicht bis nie bekannt gewordener Soul-, Blues- und Rhythm-&-Blues-Musiker, etwa Bobby Bare und Jimmy Wages, Billy Joe Shaver, Harry McClintock oder Uncle Dave Macon (Dylan über dessen Keep my skillet good and greasy: ein „Hochofen von einem Song“).
Bob Dylan knüpft an seine von ihm inhaltlich frei gestaltete Theme Time Radio Hour an, eine zwischen Sommer 2006 und Frühjahr 2009 ausgestrahlte Hörserie. Schon damals überraschte er seine Fans mit einer exquisiten, exquisit fernab des Mainstreams verorteten Auswahl an Sängerinnen, Musikern und Songs. Wer hätte vermutet, dass er etwa den Jazzstandard Black Coffee auswählte – und zwar nicht gesungen von Billie Holiday oder Carmen McRae, sondern von Bobby Darin? Und wer kannte vor dieser Sendung schon so Obskures wie The Cat’s got the measles, the dog’s got the whooping cough von Walter „Kid“ Smith und Norman Woodlief, einen Song aus dem Jahr 1929?
Sprachlich ist das überaus zugänglich, ja mehr als das. Manchmal meint man sich eher in einer (von Conny Lösch gut übersetzten) Konversation am Bartresen verortet, let’s have a whiskey or two and talk. Ausdauernd originell ist das zudem, da recht bis überwältigend subjektiv, manchmal recht quatschköpfig bis sehr bizarr. So erkennt er in Rosemary Clooneys schönlockendem Hit von 1951 Come on-a my house … den Song eines Massenmörders, der zur Besichtigung menschlicher Schädel in seinem Kühlschrank im Keller einlädt!
Nichts weniger als eine Alternativ-Geschichte der populären Musik Nordamerikas vor dem Siegeszug der StromgitarrenRockmusik ab Mitte der Sechzigerjahre ist das. Als es in den Liedtexten noch um Nöte und Arbeit und um Arbeitsnöte ging, um Lebensrisse und Andersträume, um Wortspielerisches und Wortverliebtes, auch um Sangesschmelz und ungefiltert sentimentale Sentiments. Kurz, um echte Gefühle, nicht um Synthetisches mit Synthesizern, Loops, Kommerz. Weit jenseits eines bildbasierten Musikkosmos ist das, in der – ein Beispiel: Rihannas Umbrella – sechs Produzenten das Lied fabrizieren und eine stimmlich nicht wirklich begabte Sängerin den nebensächlichsten Part beisteuert, erotisches Flair im Video. Was Dylan vorlegt, ist eine passionierte wie bemerkenswerte musikarchäologische Erweiterung des American Songbook.
Fein verästeltes Lesevergnügen. Um den kalifornischen Musikautor Greil Marcus, 77 Jahre, ist es in der letzten Dekade hierzulande merkwürdig ruhig geworden. Hatte sich einst ein Semialternativverlag wie Zweitausendeins rührig um seine klugen Bücher über Popmusik bemüht, so erschien zuletzt sein Three Songs, three Singers, three Nations. Amerika in drei Liedern in einem kleinen akademischen Verlag. 2011 wurden seine Dylan-Essays in einem Band zusammengeführt; im selben Jahr publizierte er seine Analyse der Basement Tapes.
Nun beugt er sich, ein witziger, geschmeidiger Stilist – man merkt deutlich den erfahrenen Radiokolumnisten, der er seit einer Generation auch ist –, erneut über Dylans Œuvre. Und das mit einer anderen interessanten Akzentsetzung. Er wählte sieben Songs aus der Feder Bob Dylans. Das Genrewort „Biografie“ führt eher in die Irre. Es ist vielmehr ein Werk-Spiegelkabinett. Lieder aus sieben Jahrzehnten, von Blowin’ in the Wind von 1962 über The Lonesome Death of Hattie Carroll (1964) und das weniger bekannte Jim Jones aus dem Jahr 1992 bis zum aufregend vertrackten Murder Most Foul (2020), das als frei fließender balladesker Assoziationsstrom jedes Genre gesprengt hat und zu einem seiner größten Erfolge wurde, reflektieren sich über Dekaden hinweg. Zusammen ergeben sie ein Kaleidoskop. Was Marcus von der gewaltigen Schar der Dylan-Deuter unterscheidet, sind Verve, Leidenschaft und Sprachgewalt. Selbst labyrinthische Sätze sind bei ihm ganz leicht. Das Buch ist ein großes, ungemein erhellendes und von Enthusiasmus wie von einem wahrlich beeindruckenden kreuz und quer verästelten Feinwissen des Dylan-Gesamtwerks getragenes Lesevergnügen.