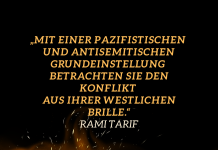»Wir jüdischen Intellektuellen, die dem Märtyrertod unter Hitler entronnen sind, haben nur eine einzige Aufgabe.
Mitzuwirken, dass das Entsetzliche nicht wiederkehrt
und nicht vergessen wird.«
Max Horkheimer
»Die Schwachen kämpfen nicht. Die Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde lang. Die noch Stärkeren kämpfen viele Jahre.
Aber die Stärksten kämpfen ein Leben lang,
die sind unentbehrlich.«
Bertolt Brecht
»Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet: Ich will ihr Sprachrohr sein, ich will die Erinnerung an sie wach halten, damit die Toten in dieser Erinnerung weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen: Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr. Überlebende müssen wie Seismographen sein. Sie müssen die Gefahr früher als andere wittern, in ihren Konturen erkennen und aufzeigen. Sie haben nicht das Recht, sich ein zweites Mal zu irren und für harmlos zu halten, was in einer Katastrophe münden kann.«
Simon Wiesenthal
Zitate. Kluge Worte von bekannten Persönlichkeiten, sie sind der Schatz und gleichzeitig die Waffe von Rudolf „Rudi“ Gelbard. Sie führt er an, wenn er dem, was er sagt, mehr Gewicht verleihen, im politischen Diskurs überzeugen will. Wer mehr über ihn persönlich erfahren möchte, dem sagt er allerdings auch am liebsten in den Formulierungen anderer, wie er sich fühlt, was ihn ausmacht, wie etwas zu interpretieren ist. Bis er dann doch ein wenig sich selbst zum Vorschein kommen lässt, ein bisschen spitzbübisch manchmal, vor allem, wenn er sich an Szenen seiner Kindheit im Vorkriegs- und seiner Jugend im Nachkriegswien erinnert und im Wiener Dialekt, „in der Sprache der Pülcher“, zu erzählen beginnt. Doch er kann auch sehr nachdenkliche Töne anschlagen. Und dann gibt es noch die traurigen, fast schon stillen Momente, etwa wenn es um seine viel zu früh verstorbene Tochter geht.
Von der Zeit in Theresienstadt aber, wohin er mit seinen Eltern 1942 als Zwölfjähriger deportiert wurde, spricht Gelbard eher distanziert, verweist vor allem auf eigene Zitate, etwa aus seiner Biografie, Die dunklen Seiten des Planeten, 2008 von Walter Kohl im Verlag Franz Steinmaßl publiziert, oder Szenen aus dem Dokumentarfilm Der Mann auf dem Balkon, für den Kurt Brazda mit ihm und seiner Frau Inge gemeinsam in den Osten reiste, nach Terezín. Man merkt, er hat schon viele Male von dieser Zeit erzählt, man merkt aber auch: Darüber will er gar nicht gerne im Detail sprechen. Denn Rudi Gelbard hat sich nie als Opfer präsentiert, nie als Zeitzeuge, der nur vom selbst Erlebten berichten möchte. Rudi Gelbard ist zwar KZ-Überlebender, ja, aber er ist vor allem „ein Fighter“, wie er selbst sagt. Wie könnte man Gelbard sonst noch in einigen wenigen Schlagworten beschreiben? Als Antifaschisten, Zionisten, Sozialdemokraten, Aufklärer, Mahner.
Ein Kämpfer aber war er, der inzwischen einen Professorentitel seinem Namen voraussetzen darf, eine der 16 Auszeichnungen, die ihm für seine Verdienste als Zeitzeuge, als Erwachsenenbildner zuteil wurden, sein Leben lang, und ein Kämpfer ist er bis heute. Zuerst ging es ums Überleben, später setzte er schon auch einmal Fäuste gegen Nazis ein, die kurz nach 1945 schon wieder an Einfluss gewinnen wollten, seit vielen Jahrzehnten aber sind seine Waffen Worte, Wissen, Zusammenhänge. Fakten sind sein Werkzeug, Bücher, Zeitungsartikel und Archive seine Helfer. Er, dem Schulbildung zunächst auf Grund der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich verwehrt blieb, eignete sich nach seiner Rückkehr nach Wien teils in der Akademie der SPÖ, teils als außerordentlicher Hörer am Zeitgeschichteinstitut der Universität Wien, vor allem aber im Selbststudium geschichtliches und politisches Wissen an.
Seine ersten großen Lehrer: Das waren keine Professoren, keine Wissenschaftler. Seine ersten großen Lehrer lernte er in Theresienstadt kennen, wo er, getrennt von seinen Eltern, mit anderen Kindern und Jugendlichen unter elendigen Bedingungen untergebracht war. „Links-sozialistisch-zionistische und sozialdemokratisch-zionistische Jugendführer“ seien sie gewesen (auch wenn er diese Einordung erst mit seinem Wissen von später vornehmen konnte), die für ihn so wichtigen fünf jungen Männer, die allesamt von den Nazis in Auschwitz ermordet werden sollten: Fredy Hirsch, Aron Menczer, Sigi Kwasnewski, Hardy Plaut, Louis Löwy. Ihnen hörte er zu, wenn sie diskutierten, hier wurde er zum Zionisten, der er bis heute ist, hier hörte er von den Pogromen in Russland, vom Dreyfus-Prozess, hier erspürte er, was Sozialismus ist, was Kommunismus.
Gelbard gab sich selbst vor einigen Jahren den Spitznahmen „Marcel Prawy des Antifaschismus“, und tatsächlich könnte man seinen Alltag nicht besser beschreiben: Wie Prawy in der Oper ein zweites Zuhause fand, so ist Gelbard in Wien immer dort anzutreffen, wo es um Antifaschismus, um Zeitgeschichte, den Holocaust, aber auch Neonazismus, die Rechte von heute geht. Die Vormittage sind der Lektüre der Tageszeitungen gewidmet, am liebsten im Café des Hotel Imperial, denn dort ist die Auswahl der aufliegenden Blätter groß. Dann geht es oft in die Bibliothek der Arbeiterkammer und abends zu Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Buchpräsentationen.

Rudi Gelbard gehört zu jenen, die sich gelegentlich im Anschluss zu Wort melden. Es sind allerdings nie lange Co-Referate, nur kurze Hinweise, verbunden mit Fragen. In der Sozialdemokratie, der er seit 1947 angehört, sind nicht nur seine Fragen, sondern auch seine Dossiers aktueller Artikel und Buchbeiträge geschätzt. Er verschickt sie per Post, nicht per Mail, denn um das Internet macht Gelbard einen großen Bogen. Nicht einmal ein Handy besitzt er, und das ganz bewusst. „Wenn Freunde etwas im Netz entdecken, was mich interessieren könnte, dann schicken sie es mir ausgedruckt, das schon.“ Aber er selbst will sich nicht in die Tiefen des Netzes begeben, obwohl er weiß, dass es für ihn eine unerschöpfliche Quelle an Dokumenten, Aufsätzen, Kommentaren wäre.
„Ich weiß genau, ich gehe dann ins Uferlose. Das ist der Grund. Ich brauche eine gewisse Ruhe. Wir ehemaligen Häftlinge ‒ es gibt doch zu denken, dass der Auschwitz-Häftling Jean Améry Selbstmord begangen hat. Dass der Auschwitz-Häftling Joseph Wulf, der mit Léon Poliakov so viele Bücher über das Dritte Reich herausgebracht hat, Selbstmord begangen hat. Dass der Bruno Bettelheim, der Buchenwald überlebt hat, am Ende Selbstmord begangen hat.“ Ob er selbst auch schon solche düsteren Gedanken gehabt habe? „Nein. Aber ich brauche Momente der Ruhe.“ Heute ist Gelbard schwer krank. Doch auch gegen seine Krebserkrankung kämpft er an, ist immer wieder im Spital für Therapien. Dennoch ist es ihm wichtig, weiter seine Stimme zu erheben.
»Angst. Ich habe Angst gehabt.«
Als SOS Mitmensch ihn während der Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ bat, kurz etwas zu den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen für ein Video, das dann auf Youtube verbreitet wurde, zu sagen, zögerte er nicht. Nur kurz reißt er darin an, dass 19 seiner Familienmitglieder die Schoah nicht überlebt haben, dann argumentiert er, weshalb eine Koalition mit den Freiheitlichen für wahre Demokraten abzulehnen sei. Dabei nennt er Namen um Namen von Naziverbrechern, die bis heute in das Totengedenken von Burschenschaften miteinbezogen werden, denen Spitzenpolitiker der Freiheitlichen angehören. Was folgte, war ein Shitstorm im Netz. SOS Mitmensch hat inzwischen die Kommentarfunktion unter dem Video selbst deaktiviert, doch wird so ein Clip erst einmal in den sozialen Medien weitergereicht, ist es schwer, der Hetze Herr zu werden. Hier ist es von Vorteil, dass Gelbard das Netz meidet. Antisemitismus ist er in seinem Leben schon genug begegnet, auch nach 1945, von Angesicht zu Angesicht.
Rudi Gelbard kam im Dezember 1930 zur Welt und wuchs in Wien auf. Hier erlebte er auch die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Insgesamt ist er um Differenzierung bemüht, betont, dass auch 1938, 1939 nicht alle Nazis waren. Da gab es einerseits auch den Widerstand und andererseits die, die bei den Reibpartien nicht zusehen wollten, die sich hinter die Vorhänge ihrer Wohnungen zurückgezogen und nicht mitgemacht hätten. Nur wer differenziert, werde der Sache gerecht, werde ernst genommen, ist Gelbard überzeugt. Ja, er wisse, manche Holocaust-Überlebenden hätten nach 1945 hier nur Nazis gesehen. Dies sei allerdings genauso falsch, wie die Rolle des Widerstands im Rückblick zu überhöhen.
Eine Szene im nationalsozialistischen Wien hat er in der Vergangenheit immer wieder geschildert. Im Buch Kohls liest sich der Vorfall so: „Plötzlich war ich umringt von HJ-Burschen. Und der eine kommt so, ich glaube, er war ein Fähnleinführer. Der war vielleicht 17 oder 18 Jahre alt, mit vier HJ-Buben. Und ich habe gedacht, jetzt ist es aus, na ja, die stampfen mich jetzt durchs Kanalgitter, wie man in Wien sagt. Ich hab zu denen gesagt: Na, was wollt’s ihr eigentlich von mir? Was hab ich euch gemacht?“ Der Anführer habe ihm dann „einen Spitz“ gegeben, einen leichten Fußtritt. „Der Judenjunge muss schon wissen, wo er in der Hackordnung hingehört. Na, und die anderen haben schon gewartet, dass sie mich endlich hauen können. Der Anführer schaut mich so prüfend an, es muss durch sein Gehirn gegangen sein, na ja, der ist so klein, und wir sind so viele, das ist doch keine Kunst. Dann hat er mir natürlich noch einen Spitz gegeben, klar, das hat er allein schon für die anderen machen müssen, und dann hat er gesagt: Na gut, Klaaner, klaaner Judenbua – schleich di, klaaner Judenbua!“ Und Gelbard rannte. Und sagt heute: „Das war noch ein Humanist, unter Anführungszeichen.“
Was sei ihm damals aber, als Kind, durch den Kopf gegangen? „Angst. Ich habe Angst gehabt.“ Wenn ein Tritt daneben geht, man an den Randstein kracht, könne so etwas auch tödlich ausgehen. Als ihn der Älteste fortgeschickt hatte, rannte er los. Den Eltern erzählte er von dem Vorfall jedoch nichts. Sie sollten nicht wissen, dass er sich auf den Straßen herumtrieb. Insgesamt wurde in der Familie nicht viel über das gesprochen, was vor sich ging. Die Ehe der Eltern war eher schlecht, die Mutter zurückhaltend, der Vater sehr gesellig, und er war es auch, der dem Sohn ein Rüstzeug der anderen Art mitgab, um ihn auf das Leben vorzubereiten: die Tom-Shark-Hefte.
Nur zwei Monate nach der Begegnung mit den HJ-Burschen wurden Gelbard und seine Eltern in das Sammellager in der Kleinen Sperlgasse verbracht. Es war 1942. Wusste man dort, was einen erwartet? Wie haben die Eltern den Sohn auf das, was kommt, vorbereitet? „Man hat da nicht groß reden müssen. Man hat ja gesehen, was vor sich geht. Man wusste nicht, was einen konkret erwartet, aber man wusste, es gibt Transporte nach dem Osten, und man wusste, es wird grauenhaft werden.“ Bis heute ist er dem Vater aber dankbar, dass er versucht hat, ihm mit den Tom-Shark-Heften „ein bisschen die Wirklichkeit zu nehmen“.
Die Wirklichkeit holte ihn in Theresienstadt ohnehin brutal ein. Zum einen die Trennung von den Eltern, die vielen Sterbenden, die elenden Lebensbedingungen. Fast wäre er selbst an einer Lungenentzündung gestorben. Dazu kamen jedoch Situationen, die selbst in der Erzählung unaushaltbar scheinen. Gegen Ende des Krieges, im März, April 1945, kamen immer noch Züge mit deportierten Jüdinnen und Juden in Theresienstadt an. „Wir mussten die Waggons aufmachen, da waren sehr viele Tote und völlig verrohte noch Lebende, und wir mussten sie mit einem Stock voneinander trennen. Wir haben immer ein bisschen Essen aufgespart, aber da hat jeder jedem, egal ob Professor für Ethik oder Arbeiter, das Brot aus dem Mund gerissen.“
Was geht in einem solchen Moment in einem vor? „Man denkt nur daran, dass man sie trennen muss, mit dem Stock. Und da war eine Partieführerin, eine blonde, blauäugige Tschechin, eine Jüdin. Die hat gesagt, Rudi, das darfst du nie vergessen, das darf nie wieder vorkommen. Aber dass Menschen so verrohen, das kann man ihnen nicht vorwerfen.“ Und der Anblick von Toten? „Das ist natürlich erschütternd. Die Erinnerung bleibt.“ Hat er noch Bilder im Kopf? „Lange Zeit schon, aber irgendwann sind sie verschwunden.“
„Es ist keine stille Machtergreifung, sondern
eine Kriegserklärung an Demokratie, Verfassung und unsere politische Kultur der Menschenrechte und des Miteinander.“
Ebenfalls kurz vor Kriegsende, die Alliierten waren bereits auf dem Weg nach Theresienstadt, wollten die Nazis alle Beweise vernichten, darunter auch die Pappurnen mit den verbrannten Überresten der im Lager Verstorbenen und Ermordeten. Gelbard wurde dazu eingeteilt, mit anderen auf einem Kipplaster zu stehen und die Kartons aufzureißen – die Asche sollte später in den Elbe-Nebenfluss Eger gekippt werden. „Das war eine grauenhafte Geschichte. Ich war da am Lastwagen. Ich habe die Urnen aufgerissen, und das ist heruntergekullert. Ich hatte Asche auf den Füßen, und Knochen. Es ist ja nicht total verbrannt. Ich bin dann in einem Berg von Asche gestanden.“ Hat man dann das Bedürfnis, sich sofort zu waschen? Wie hält man so eine Situation aus? „Man war ja im Lager abgestumpft. Man gewöhnt sich an viele Dinge. Die Abschiede zum Beispiel, die man am Bahnhof beobachten konnte. Unglaublich, an was sich der Mensch gewöhnt.“
Und dann, als das Lager befreit, der Krieg zu Ende, die Familie nach Wien zurückgekehrt war? „Man gewöhnt sich an das normale Leben. Die Relationen stimmen allmählich wieder. Sie stimmen nie ganz, weil die Erinnerung bleibt, aber man kann ja nicht als ewiger Neurotiker herummarschieren. Ich kenne einen Mann, der geistig in Auschwitz geblieben ist. Das habe ich versucht zu vermeiden. Ich habe schon mein Leben gelebt. Ich war ein guter Boogie-Tänzer!“ Die erste Ehe ging vor allem deshalb in die Brüche, weil er politisch so aktiv war. Mit seiner jetzigen Frau Inge ist er aber seit 1990 glücklich verheiratet. „Und es funktioniert, weil jeder sein Leben hat.“ Er den Antifaschismus – sie Tai Chi und Qi Gong.
Dass es gar nicht so leicht ist, zur Normalität zurückzukehren, wenn einem die Umgebung immer noch feindlich gesinnt ist, das musste Gelbard als Teenager rasch lernen. Als man die Familie im zweiten Bezirk nach ihrer Rückkehr aus Theresienstadt erkannte, wurde der Vater gefragt, warum er noch lebe, warum er nicht vergast worden sei. Und bei einem Besuch mit Freunden im Kino noch im Jahr 1945, bei dem sie sagten, sie seien Überlebende, und fragten, ob sie den Film wohl stehend sehen könnten, da wurden sie von anderen Kinobesuchern als „Saujuden“ und „Scheißjuden“ beschimpft, und es wurde bedauert, dass sie nicht – wieder dieser furchtbare Begriff – vergast worden seien.
Es waren Szenen wie diese, die Gelbard an das denken ließen, was er in Theresienstadt erlebt hatte, und welche den Kämpfer in ihm weckten. Stolz ist er auf seine Zeit in der Bricha, auch wenn er dort nur ein kleines Rädchen gewesen sei. Als 16-Jähriger – rückblickend sagt er, er sei immer der Jüngste gewesen, was aber heute bedeutet, dass er einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen sei – mischte er sich zum ersten Mal aktiv als Antifaschist ins Geschehen. An der Universität versuchten 1946 ehemalige Nationalsozialisten eine Vorlesung über die Geschichte der Juden im Mittelalter zu stören, Gelbard beteiligte sich an einer ganztägigen Belagerung der Hochschule. „Das war der Anfang.“
Noch öfter sollte er „bei harten antifaschistischen Aktionen involviert sein“. 1948 war er dabei, als sich im Hotel Wimberger ehemalige „Ariseure“ zur Gründungsversammlung des „Verbands der Rückstellungsbetroffenen“ trafen. Ein Euphemismus, der ihn bis heute wütend macht, ebenso wie das Verhalten vor allem der eintreffenden Damen, einige im Pelz, den protestierenden Holocaust-Überlebenden gegenüber. Die Veranstaltung wurde von ihm und anderen „gesprengt“, wie es Gelbard formuliert. Gesprengt hat er 1955 auch eine Neonaziversammlung im Hotel Münchnerhof, damals wollte der zu dem Zeitpunkt schon ausgeschlossene VDU-Nationalratsabgeordnete Fritz Stüber eine Veranstaltung unter dem Titel Hungerrenten und die jüdischen Forderungen an Österreich abhalten.
1959 war Gelbard an den schweren Straßenauseinandersetzungen anlässlich der so genannten Schiller-Feier beteiligt, dem erstmaligen Aufmarsch volkstreuer Verbände, Deutschnationaler und neonazistischer Gruppen nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien. Zu schweren Schlägereien kam es auch im März 1965 im Zug der Borodajkevic-Affäre, bei denen Ernst Kirchweger getötet wurde. Gelbard sah ihn in seinem Blut liegen ‒ und ist heute erleichtert, dass es damals nicht noch mehr Tote gab. In den 1970er-Jahren störte und verunmöglichte er mit vielen anderen einen Vortrag des amerikanischen Revisionisten David Hoggan in Wien-Neubau, in den 1980er-Jahren einen Vortrag des britischen Holocaust-Leugners David Irving im Parkhotel Hietzing. Demonstrieren gingen Gelbard und seine Mitstreiter aber auch „gegen Freisprüche österreichischer Gerichte von NS-Judenmördern“.
Später beobachtete er alle Neonaziprozesse – jene gegen Gerd Honsik ebenso wie die gegen Gottfried Küssel (zuletzt wurde dieser 2013 im Rahmen des Verfahrens wegen der Website Alpen-Donau.info zu neun Jahren Haft wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz verurteilt). Jüngst ging er mit anderen Überlebenden gegen die rechte Zeitschrift Aula vor. In dieser wurden Überlebende des Konzentrationslagers Mauthausen als „Massenmörder“ und „Landplage“ bezeichnet. Das Verfahren ging durch alle Instanzen, das Medium musste schließlich widerrufen. Gelbard weiß aber, was er davon zu halten hat. In der darauffolgenden Ausgabe sei die Aula weiterhin mit FPÖ-Inseraten bedacht worden. Und in der Jubiläumsausgabe sei das Medium dann von führenden FPÖ-Politikern gelobt worden, weil es gegen den Mainstream schreibe.
Aber auch beruflich widmete er sich zunehmend der zeitgeschichtlichen Recherche. Als Jugendlicher hatte er einen Handelsschulabschluss nachgeholt, dann zunächst in der Firma des Vaters gearbeitet, der jedoch sehr geschwächt aus Theresienstadt zurückgekehrt war und rasch verstarb, war dann zehn Jahre in der Erhebungsabteilung des Sozialministeriums tätig, um schließlich für weitere zehn Jahre als Marktfierant für Stoffe zu arbeiten. 1975 jedoch öffneten sich ihm die Türen zu seinem Traumberuf. Im Kurier wurde er Mitglied der Ombudsmannredaktion und Dokumentarist für Zeitgeschichte. Er recherchierte für zeitgeschichtliche Artikelserien, bereitete für den damaligen Chefredakteur Franz Ferdinand Wolf Material für dessen ORF-Sendung Zu Gast bei Dr. Wolf im Theater der Josefstadt vor, und arbeitete Hans Rauscher bei einem Buch sowie Peter Pisa und Hans-Henning Scharsach zu.
Als er 1991 in Pension ging, zog er sich allerdings nicht ins Privatleben zurück: Nun begann er, als Zeitzeuge Schulen zu besuchen, Vorträge zu halten, Buchpräsentationen zu moderieren. Er spreche dann aber nicht von seinem persönlichen Leid, sage nur, wie auch in dem SOS-Mitmensch-Clip, dass große Teile seiner Familie von den Nazis ermordet wurden, dass er selbst Theresienstadt überlebt hat. Larmoyanz lehne er ab, überzeugen wolle er mit Fakten, mit Informationen, wie das Dritte Reich entstehen konnte und wie es funktionierte. Zurechtgelegt hat er sich dafür auch eine ganz eigene Sprache mit Begriffen, die beschreiben, was war: Vernichtungslager nennt Gelbard zum Beispiel stets „Menschenvernichtungsfabriken“, die Einsatzgruppen A, B, C und D, die den Gaskammern vorausgingen, „Schlachthäuser auf Rädern“.
Lange überlegte er, wie er eine Rede im Jahr 2016 vor der Bundesregierung anlässlich eines Staatsaktes zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus anlegen sollte. „Das war eine schwere Aufgabe. Ich bin dann auf die Idee gekommen, ich beginne wie ein Tatort.“ Und das tat er dann auch. „12. März 1938 – im Wittelsbacher Palais, dem Münchner Hauptquartier der Gestapo, drängte es den Reichsführer SS Himmler nach Österreich. Um 0.45 Uhr berichtete der SS-Führer Kaltenbrunner telefonisch aus Wien über die Lage …“
Was ihn bis heute zornig macht, ist die Verharmlosung von Theresienstadt, wenn vor allem herausgestrichen würde, was es dort an Kulturveranstaltungen gab. „Theresienstadt war eine Station auf dem Weg in die Vernichtung.“ Ja, er wisse, dass das Leid in Auschwitz-Birkenau, in Majdanek, in Chelmno noch größer gewesen sei, und das spreche er auch selbst im Gespräch mit anderen Überlebenden an. Was aber Theresienstadt anbelange, greife da bis heute die Propaganda der Nazis, die in dem Film Der Führer schenkt den Juden eine Stadt gipfelte. „Theresienstadt war jedoch ein sehr trauriger Ort.“ Die Bilder aus der Zeit damals mögen verblassen, die Erinnerung verblasst nie.
Worüber er sich freuen würde, dass einmal über ihn gesagt wird? „Er hat versucht, die jüdische Sache in Hinblick auf den industriellen Massenmord mit Fakten, ohne Fanatismus, aber wenn nötig kämpferisch zu vertreten. Ich habe nur nicht erwartet, dass ich die Möglichkeit dazu bekomme. Das hat sich dann nach und nach ergeben.“
Dieser Tage wird Gelbard oft interviewt, wenn es um die Einschätzung der innenpolitischen Lage geht. Doch dass es so kommen wird, das hat er bereits vorausgesehen. Schließlich hat er auch Scharsach einst für dessen 1993 erschienenes Buch Haiders Kampf zugearbeitet. Zu dessen jüngstem Werk Stille Machtergreifung: Hofer, Strache und die Burschenschaften hat er allerdings eine wichtige Anmerkung: „Was hier dokumentiert wird, ist keine stille Machtergreifung, sondern eine Kriegserklärung an Demokratie, Verfassung und unsere politische Kultur der Menschenrechte und des Miteinander.“