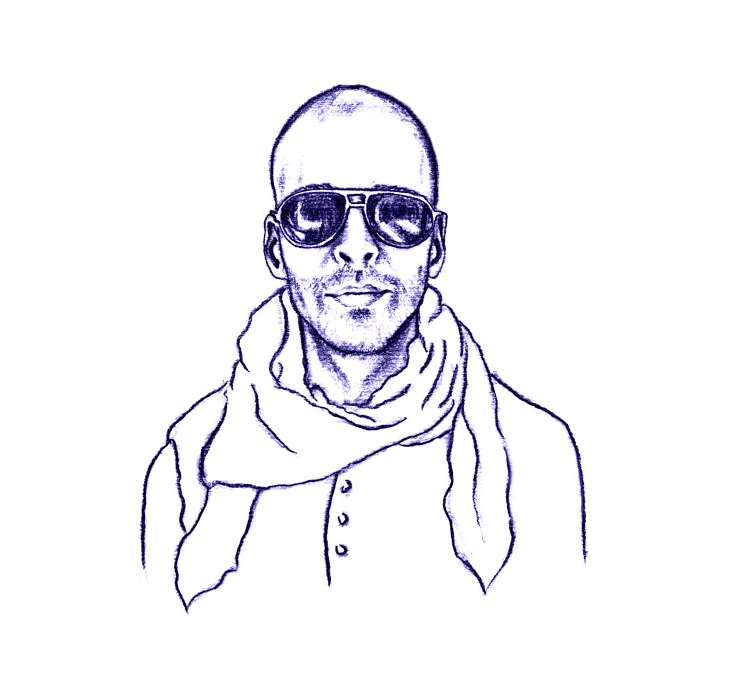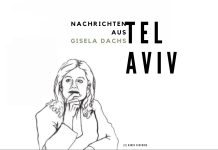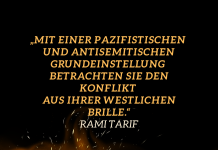Jüdin sucht Juden, Heirat erwünscht: In einem Selbstversuch macht sich 2005 die dreißigjährige jüdische Regisseurin Gabrielle Antosiewicz auf den Weg, in Zürich einen Partner zu finden. Von Manja Altenburg
Neugierig darauf, was sich so auf dem schweizerisch-jüdischen Heiratsmarkt tummelt, begibt sich Gabrielle Antosiewicz auf die Suche nach dem geeigneten Mann. Wie „koscher“ soll er (für sie) sein? Eine wichtige Frage, denn schließlich bezeichnet sie sich als eine klassische „Dreitagesjüdin“, eine gängige augenzwinkernde Selbstbezeichnung für alle diejenigen, die ihr Judentum hauptsächlich an den drei höchsten jüdischen Feiertagen praktizieren. Um also herauszufinden, welche Bedeutung das Judentum für sie persönlich in einer Ehe hat, lädt sie vier Heiratskandidaten nacheinander zum „Casting“ in ihre Küche ein. Dort müssen die Anwärter mit ihr die Challa, den traditionellen Hefezopf, den man am Schabbat isst, backen. Für Antosiewicz ist die Küche der geeignete Ort, um etwas über den zukünftigen Gemahl herauszufinden. Nicht nur, um zu erkennen, wie er es mit der Rollenverteilung hält, sondern auch, um gleich zu sehen, wie er sich am Herd anstellt. Antosiewicz’ „Küchencasting“ bietet witzige und gleichzeitig tiefe Einblicke in das Verhalten paarungswilliger Singles. Diskussionen über nichtkoschere Lebensmittel und darüber, für die Liebe seines Lebens zu einer anderen Religion zu konvertieren, entspinnen sich während der Ofen läuft. Diese amüsanten Sequenzen werden durch Interviews abgerundet, in denen junge und ältere, säkulare und orthodox lebende Juden aus drei Familien zu Wort kommen. Über ihren Film, ihre Erfahrungen und „koschere Männer“ sprach wina mit der Regisseurin.
wina: Wie kamen Sie auf die Idee zu „Matchmaker“?
Gabrielle Antosiewicz: Ich konnte mich mit keinem der vielen Berichte über jüdisches Leben in der öffentlichen Diskussion identifizieren. Und ich empfand auch, dass das Thema „Judentum“ immer gleich mit so einer Ernsthaftigkeit angegangen wird, die nicht selten in politischen Israeldiskussionen endet.
wina: Inwiefern haben Sie Ihre filmischen Dating-Erlebnisse verändert?
GA: Eigentlich gar nicht, allerdings war die „Dating-Frequenz“ so hoch, dass ich im Anschluss an den Film erst mal ein Jahr pausieren musste.
wina: Hatten Sie solche Datings überhaupt jemals wirklich vor Augen oder war der Anlass eher ein augenzwinkernder?
GA: Die Dates waren Mittel zum Zweck. Ich wollte die klassischen Portraits über jüdisches Leben mit etwas ganz anderem brechen.
wina: Wie stehen Sie heute zu jüdischen Online-Dating-Portalen? Hat sich Ihre Meinung dazu irgendwie verändert?
GA: Damit habe ich keine Erfahrungen.
„Natürlich befriedigt der Film nicht alle Facetten des Judentums, es gibt noch viele weitere Formen jüdischen Lebens.“
GA: Weil ich mein Judentum sowieso in eine Partnerschaft einbringe. Ich teile auch die Meinung nicht, dass sich später meine Kinder weniger jüdisch empfinden werden als ich. Ich komme aus einer sehr offenen und multireligiösen Familie, bei uns findet alles seinen Platz. Das möchte ich neben meinem Judentum gerne leben und vermitteln.
wina: Vertreten Sie diese Meinung heute noch?
GA: Vertrete ich noch immer und lebe sie auch bestens. Ich feiere Channukka genauso wie Weihnachten. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diejenige bin, die für die jüdischen Feiertage in der Familie verantwortlich ist.
wina: Wie haben Ihre Freunde darauf reagiert, dass der Film entstand und dann auch in den Kinos gezeigt wurde?
GA: Sie haben geschmunzelt.
wina: Hatten Sie Unterstützung von jüdischer Seite für Ihr Vorhaben? Wenn ja von wem?
GA: Die erste finanzielle Unterstützung für den Film überhaupt habe ich von der evangelischen Kirche in Zürich bekommen. Das hat mir besonders gut gefallen. Glücklicherweise hatte ich von allen Seiten Unterstützung. Gerade die Suche nach den Protagonisten wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn nicht jeder jemanden gekannt hätte, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Jüdische Mispochologie.
wina: Wie waren die Reaktionen auf Ihren Film von jüdischer Seite?
GA: Es waren vor allem positive Reaktionen. Und selbstverständlich, wie das in unserer Kultur üblich ist, gab es auch Kritik und Vorschläge, was man hätte anders machen können. Natürlich befriedigt der Film nicht alle Facetten des Judentums, es gibt noch viele weitere Formen jüdischen Lebens.
wina: Und die Reaktionen auf Ihren Film von nichtjüdischer Seite? Gab es hier Unterschiede zu den jüdischen Reaktionen?
GA: Diese Seite war vor allem sehr dankbar für diesen Film. Er ermöglichte ihnen einen anderen Blick in jüdische Welten. Ich bekam nach dem Film mehr Zuschriften von christlicher Seite – auch von Männern …
wina: Hatten Sie während der Produktion des Filmes je das Gefühl, dass Ihnen die klassischen Klischees über jüdische Männer begegnen?
GA: Mit solchen Klischees kenne ich mich nicht besonders gut aus. Sie konnten alle nicht besonders gut eine Challe backen, erfüllt das vielleicht ein Klischee?
wina: Was war Ihr lustigstes Erlebnis bei den Dreharbeiten?
GA: Eine Klischee-Geschichte: Als wir im Brautgeschäft ein passendes Brautkleid für mich gesucht haben, kam der Besitzer herein und sagte ganz erstaunt: „Sie sind ja gar nicht klein!“ – Das wusste ich bis dahin auch nicht: dass jüdische Frauen klein sein müssen …
wina: Haben Sie noch einen guten Rat für jene Leser, die sich gerade auf der Suche nach dem „koscheren“ Partner fürs Leben machen?
GA: Ach, wenn ich das könnte, dann wäre ich heute selber ein „Matchmaker“! Ich persönlich finde auf jeden Fall Humor sehr wichtig – und den sollte man auf der Suche nach dem richtigen Partner auch nicht verlieren.