
Es gab ein Leben vor Dustin Hoffman. Und: Es gab ein Leben vor Watergate. Heuer wird sich der Einbruch im Watergate-Gebäudekomplex in Washington zum 50. Mal jähren. In der Nacht zum 17. Juni 1972 wurde in den Büros, die das Democratic National Committee, die Zentrale der Demokratischen Partei, gemietet hatte, ein Einbruch bemerkt. Die Polizei verhaftete fünf Männer. Die Spur der Einbrecher führte zur Republikanischen Partei und zu hohen Mitarbeitern im Weißen Haus. Am 9. August 1974 trat Präsident Richard Nixon zurück, beschämt und das Amt erniedrigt.
Dass die gesamte Affäre so gründlich, so detailliert und in Gänze aufgedeckt wurde, verdankte man zwei jungen Reportern der Washington Post, die durch die „Watergate-Affäre“ weltbekannt wurden: Bob Woodward und Carl Bernstein. Zusammen schrieben sie das Buch All the President’s Men. 1976 wurde es mit Robert Redford als Woodward und dem quecksilbrig-wuseligen Dustin Hoffman als quecksilbrig-wuseliger Bernstein verfilmt. Sie waren ziemlich gegensätzlich, weshalb sie sich ergänzten. Woodward war Sohn eines Richters aus Illinois und Absolvent der Yale University. Er hatte sich aus einem Shakespeare-Seminar heraus 1971 bei der Post als Reporter beworben und war genommen worden. Bernstein, im Februar 1944 geboren und somit um elf Monate jünger als Woodward, hatte ihm gegenüber zehn Jahre Vorsprung als Zeitungsmann. Er war analytischer, erkannte Zusammenhänge. Und war wilder.
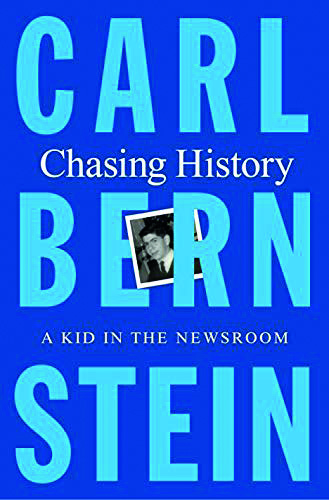
Von seinen Anfängen erzählt Bernstein, gebürtiger und leidenschaftlicher Washingtonian, nun höchst lebendig. Er entstammt einer jüdischen, sehr linken Familie. Seine in Gewerkschaften aktiven Eltern hatten Mitte der 1940er-Jahre ihre Jobs in der Regierungsverwaltung verloren, wurden während McCarthys Antikommunismus-Hatz fast kriminalisiert, vom FBI überwacht. Sie betrieben in Silver Springs, einem Vorort von Washington, eine Putzerei, um erst ab Ende der 1950er-Jahre wieder in einer NGO politisch aktiv zu werden.
1960/1961 begann Carl Bernstein bei The Washington Star als Copy Boy, Laufbursche, seine Zeitungskarriere. Mit Verve und enormer Farbigkeit zeichnet er nach, mit welchen pittoresken Profis er zusammenarbeitete und wie damals journalistisch gearbeitet wurde: Es gab eine ganze Abteilung mit Ferndiktate Entgegennehmenden, das waren jene, die am schnellsten Schreibmaschine schreiben konnten und denen die Außenreporter von öffentlichen Fernsprechern aus ihre Berichte durchgaben. Es gab langsame Fernschreiber. Mit am wichtigsten war: die Nähe zu einem Telefon. Und noch wichtiger: die Wahrheit. Großartige Geschichten präsentiert Bernstein, der sein Studium versanden ließ, weil er entdeckte, welch Vollblutjournalist in ihm steckte.
„In meinem ganzen Leben hatte ich nie solch glorioses Chaos erlebt oder solch absichtliche Hektik gesehen wie nun im Newsroom. Nachdem ich von einem Ende zum anderen gegangen war, wusste ich, dass ich ein Zeitungsmann werden wollte.“
Carl Bernstein
Das Ganze liest sich prächtig. Bernstein schreibt brillant. Das wird deutlich, wenn man auf den vermessenen Gedanken verfällt, Partien ins Deutsche zu übertragen. Da merkt man erst, mit welch rhythmischer Präzision er seine Sätze konstruiert, Absätze aufbaut, seine Dramaturgie orchestriert. Man kann nur bedauern, dass Bernstein ab den späten 1970er-Jahren für Fernsehnachrichtensender wie CNN und ABC gearbeitet und so wenig geschrieben hat. Seine Bücher über den polnischen Katholikenpapst Johannes Paul II. und über Hilary Clinton anno 2007 waren die eher pittoreske Ausnahme.
Vor genau dreißig Jahren beklagte er in einem längeren Artikel, The Idiot Culture, einen debil unseriösen Journalismus, der fahr- wie nachlässig Nachrichten und Klatsch sowie Tendenziöses miteinander vermengt. Damit beschrieb er jene Entwicklungen, mit denen sich heute die Medien plagen und die die Nachrichtenpräsentation prägen. Chasing History ist eine eindrückliche Erinnerung daran, wie ernst einst journalistische Standards genommen wurden. Und wie hoch diese waren.
Hier wurde Geschichte erlebt. Chasing History, Geschichte nachjagen, ist ein Titel voll Ambivalenz. Bernstein erzählt von den Jahren 1960 bis 1966. Nach fünf Jahren war er amEnde seines Karrierepotenzials bei der Zeitung angekommen, deren fiebrige, engagierte Lokalberichterstattung die der Post um Längen schlug. Er wechselte kurz als einzig dem Chefredakteur verantwortlicher Reporter zu einer kleinen Zeitung in New Jersey. 1966 kehrte der eingeschworene Washingtonian Bernstein in die USHauptstadt zurück und fing bei der Washington Post an, die da schon Katherine Graham zu leiten begonnen hatte, welche eine Riege hochbegabter, hochambitionierter Redakteure einstellte, darunter als leitender Redakteur Ben Bradlee, der 1972 dem jungen dynamischen Duo Woodward & Bernstein weite Leine ließ.
Zugleich signalisiert der Titel: Hier wurde Geschichte erlebt. Gemacht. Eingefangen. Bernstein schreibt über John F. Kennedy und das Attentat, er rapportiert ausführlich den Kampf der Afro-Amerikaner um Gleichberechtigung und Teilhabe – einhundert Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei durch Abraham Lincoln. Und es findet sich eine Fülle anderer Gesellschaftsgeschichten, die noch heute erstaunlich aktuell anmuten, von Gewalt zu Paranoia, Machtmissbrauch, Rassismus, Antisemitismus.
Bernstein gelingt es, ein hinreißend lebendiges Zeithistorie-Panorama zu zeichnen, voller Ironie und Witz und Geist. Das noch Erstaunlichere: Seine Prosa ist frei von jeglicher Nostalgie.

























