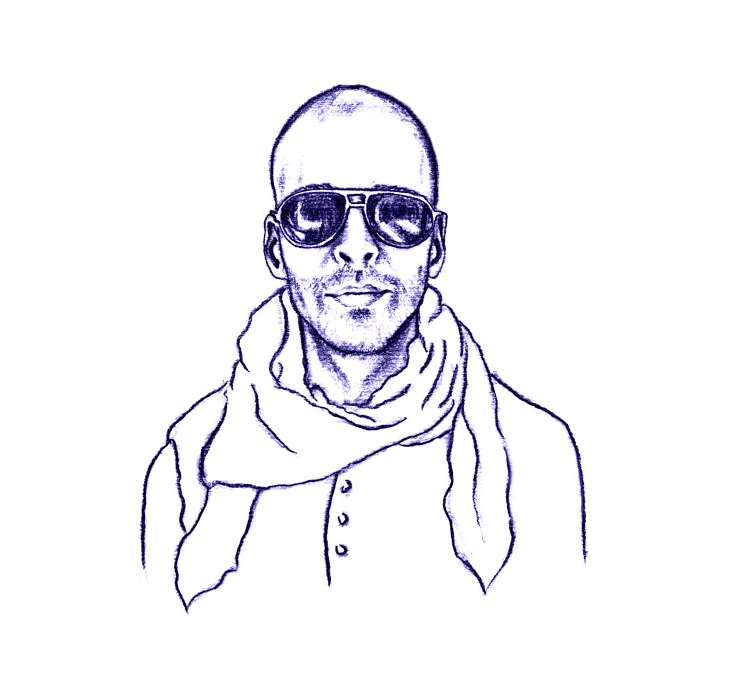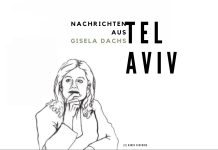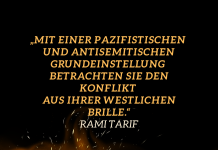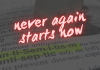Die Zeit des Nationalsozialismus ist noch lange nicht gänzlich erforscht. Die aktuelle Auseinandersetzung mit dieser Zeit fokussiert sich allerdings nicht mehr nur auf das, was sich zwischen 1933 und 1945 zugetragen hat, sondern auch auf die Auseinandersetzung mit den darauffolgenden Jahrzehnten. WINA traf drei junge Historikerinnen, die sich in den vergangenen Jahren mit sehr spezifischen Aspekten der NS-Zeit beziehungsweise deren Verarbeitung auseinandergesetzt haben.
Von Alexia Weiss
Lebensgeschichte in Bildern

Vida Bakondy blättert durch ein Fotoalbum. Es zeigt Aufnahmen aus den 1940er-Jahren, man wähnt sich auf einer touristischen Exkursion in die Schweiz. Festgehalten wurde hier allerdings keine Urlaubsreise, sondern eine Flucht – die von Fritzi Löwy, einst Schwimmerin von Weltrang mit Heimat in der Wiener Hakoah. In einem anderen Fotoband hat sie zwei Aufnahmen eingeklebt, die ihr ihre Schwester aus dem Ghetto Opole schickte. Zu sehen ist diese darauf mit ihren drei Töchtern. Fotos aus dem Ghetto? Die Menschen hatten damals eine Kamera mit in ihrem Gepäck? „Ein Fotograf im Ghetto wurde mit der Aufnahme der Bilder beauftragt, diese wurden dann an Angehörige und Freunde verschickt“, erklärt Bakondy.
Bakondy hat eben ihre Dissertation fertiggestellt. Darin hat sie den – kleinen und sehr fragmentarischen – Nachlass der Schwimmerin aufgearbeitet, der sie schon bei der ersten Sichtung in ihren Bann zog. Wobei sie betont, dass es ihr bei ihrer Arbeit nicht um das Erstellen einer Biografie ging. Im Fokus standen vielmehr drei Fotoalben, die Löwy – sie verstarb 1994 in Wien – hinterließ und die nach ihrem Tod auf dem Flohmarkt landeten. Jahrelang blieben sie in Privatbesitz, bis sie dann an die Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien übergeben wurden. Bakondy recherchierte nach Sichtung der Bilder weiter – stieß auf einen weiteren Nachlass Löwys in einem Privat-archiv in Schweden, auf ein ausführliches lebensgeschichtliches Interview, das die Historikerin Gabriele Anderl mit Löwy geführt hatte, aber auch auf noch lebende Verwandte in Australien und in den USA.
Langsam setzte sie das Puzzle jedes Fotos zusammen: Was ist darauf zu sehen, was bedeutet es in der Lebensgeschichte Löwys, aber was bedeutete es auch für ihr Erinnern in der Nachkriegszeit. Warum hat sie ihre Exilzeit in der Schweiz von 1944 bis 1945 – sie war zunächst von Wien nach Mailand emigriert, wo sie einige Jahre verbrachte, bis sie sich schließlich in die Schweiz rettete – wie eine Reise dargestellt? Was bedeuteten ihr die Aufnahmen aus Opole? Aber auch: Was wollten die Menschen, die in dieses Ghetto (und von dort aus in den Tod in einem Vernichtungslager wie Treblinka) deportiert wurden, ihren Lieben über diese Aufnahmen mitteilen? Dass alles nicht so schlimm ist?
„Eine der Aufnahmen aus dem Ghetto zeigt Fritzi Löwys Schwester und ihre drei Nichten in einem Innenraum. In einer Ecke sieht man eine Bilderwand, da ist auch ein Foto der Mutter Fritzi Löwys zu sehen, und es ist klar, diese Fotoecke musste da unbedingt auf das Bild mit darauf. In dem Brief, dem das Foto beigelegt wurde, schreibt die Schwester auch weniger über die Personen auf der Aufnahme als vielmehr über die Fotoecke und wer da aller abgebildet ist. Das Foto hatte auch die Aufgabe, die Angehörigen zu beruhigen.“
Aufnahmen wie diese gäben viel über die Bedeutung von Fotografien für die in osteuropäische Ghettos deportierte Menschen preis, sagt Bakondy. Sie hat allerdings nicht nur die Bilder analysiert, sondern sie mit historischen Quellen verknüpft und so einen Kontext hergestellt. Warum trugen die Frauen in Wien zum Beispiel keine Kopftücher, in Opole dann aber schon? „Vermutlich haben sie das getan, um sich vor Läusen zu schützen. Sie passten sich also an die lokalen Gegebenheiten an.“
ORF und Opfermythos

Repräsentationen des Nationalsozialismus im österreichischen Fernsehen 1955–1970.
Renée Winter ist für ihre Dissertation viele Stunden vor dem Fernseher gesessen. Sie sah sich an, wie das ORF-Fernsehen von seiner Geburtsstunde 1955 bis 1970 die NS-Zeit dargestellt hat. Manche ihrer Hypothesen wurden bestätigt: Der Opfermythos stand im Vordergrund, der Widerstand wurde überbewertet – dabei aber die Großparteien in den Vordergrund gestellt und jener von kommunistischer Seite eher heruntergespielt, und Konsens wurde großgeschrieben. Anderes hat sie überrascht: Eine vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) konzipierte Sendung brachte Zeitzeugen und Zeitzeuginnen vor die Kamera – auch jüdische. Das widerspreche der oftmaligen Darstellung, dass man auch in der Nachkriegszeit vieles noch nicht gewusst habe, sagt Winter. Wer hinhören wollte, hatte bei dieser Sendung die Gelegenheit dazu.
Ausgewertet hat Winter einerseits Dokumentationen, andererseits Kabarettsendungen. In Letzteren wurde vieles übrigens wesentlich offener angesprochen: vor allem in den Sketches der Unterhaltungskünstler Gerhard Bronner und Peter Wehle. Warum? „Vielleicht, weil man Unterhaltung eben nicht so ernst genommen hat. Bei Dokumentationen wurde dagegen alles mehrmals geprüft.“
Die Motivation für diese Forschungsarbeit zog Winter aus ihrer Unzufriedenheit auch mit dem gegenwärtigen Geschichtsfernsehen. „Immer noch wird vieles wiederholt, die Perspektive der Geschichtsschreibung der Nachkriegsjahre fortgeschrieben“, bekrittelt sie. Gerade erst seien Österreich I und Österreich II von Hugo Portisch wieder aufgelegt worden. Konsens werde großgeschrieben, Konflikt sei negativ besetzt. „Ich finde, das ist ein Fehler.“
Beschäftigt hat sie sich auch mit der Auswahl und Verwendung von Fotos in TV-Dokumentationen. Häufig sei Material, das in der Nachkriegszeit oft vervielfältigt wurde, in unpassenden Kontexten verwendet worden, meint Winter.
So wurde etwa ein Foto, das einen Deportationszug mit jüdischen NS-Opfern in Polen zeigt, eingesetzt, um das Verbringen politischer Häftlinge ganz zu Beginn des NS-Regimes auf österreichischem Boden nach Dachau zu illustrieren. Bei einem anderen, sehr häufig benutzten Foto, das einen Mann zeigt, der „Jud“ auf eine Wand schreiben musste, neben ihm ein NS-Scherge, ist der gewählte Bildausschnitt interessant: Die Zuschauenden wurden stets weggeschnitten. Auf dieses Phänomen habe kürzlich auch Ruth Beckermann mit ihrer das Denkmal von Alfred Hrdlicka ergänzenden Installation hingewiesen.
Während Bakondy sich anhand eines individuellen Nachlasses ansah, wie eine Überlebende privat ihr Schicksal sowie jenes ihrer Familie dokumentierte und präsentierte, analysierte Winter die Haltung des Nachkriegsösterreich, repräsentiert durch das österreichische Staatsfernsehen.
Strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen vor und nach 1945
Die Historikerin Elisa Heinrich wiederum befasste und befasst sich mit dem Gedenken an eine noch Jahrzehnte nach 1945 verfolgte Opfergruppe: Homosexuelle.
Die Häftlinge mit dem rosa Winkel (nur männliche Homosexuelle wurden mit diesem Symbol stigmatisiert), welche die Lager der Nazis überlebt hatten, kehrten in ihre Heimat zurück, um hier erneut strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt zu sein, denn in Österreich (in Deutschland ebenfalls) blieb Homosexualität auch nach 1945 strafbar. Wenn LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)- Aktivisten sich heute für Erinnerungsorte auch für die in der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen engagieren, spiele hier immer noch eine aktuelle Identitätsdebatte hinein, so Heinrich. Immer noch sei man mit einer marginalisierten Opfergeschichte konfrontiert. Ähnliches gelte auch für die Gruppe der sogenannten „Asozialen“.
„Der Wunsch nach Gedenken dient auch der Selbstvergewisserung der eigenen Identität.“ Elisa Heinrich

Wichtig ist Heinrich zu betonen, dass die Verfolgung lesbischer Frauen zwar zahlenmäßig nicht mit jener schwuler Männer vergleichbar war, Lesben aber dennoch strukturelle Einschnitte, Überwachung und Denunziation erlebten. In Konzentrationslagern wurden sie allerdings oft auf- grund anderer Verfolgungsgründe interniert: als politische Häftlinge zum Beispiel. Oder eben als „asozial“. Das macht es auch schwierig, hier genaue Zahlen zu nennen. Für homosexuelle Männer ging man anfänglich durch Analogien zu jüdischen Opfern von sehr hohen Opferzahlen aus, diese wurden inzwischen stark nach unten korrigiert. Es könne von 5.000 bis 15.000 Rosa-Winkel-Häftlingen in KZs ausgegangen werden, so Heinrich. Etwa die Hälfte von ihnen habe den NS-Terror nicht überlebt.
Spannend findet Heinrich bei dieser Forschungsarbeit „die Frage nach Identität und Gedächtnis. Der Wunsch nach Gedenken dient auch der Selbstvergewisserung der eigenen Identität. Es soll zum Beispiel mit Mahnmalen also auch im Heute ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt werden.“ Interessant findet die Historikerin auch die Frage der Integration von Transgender-Personen in das Gedenken. Diese waren damals offiziell gar nicht von Verfolgung betroffen. Heinrich erzählt hier von der Ausstellung von Transvestitenscheinen auch während der NS-Zeit. Zugleich gab es aber auch Überschneidungen mit der Verfolgung von Homosexuellen. Hier sieht sie ein spannendes Forschungsdesiderat.
Das Fazit Heinrichs ist denn auch überraschend: Statt Mahnmalen über verfolgte Homosexuelle in der NS-Zeit (in Österreich gibt es bisher nur temporäre Installationen zu dem Thema, aber kein festes Denkmal) wünscht sie sich eine Ausstellung, ein Museum, an dem LGBT-Lebensweisen und die verschiedensten Formen ihrer Unterdrückung dokumentiert werden.
Was Heinrich, Bakondy und Winter eint, sind allerdings nicht nur ihre sehr individuellen Blicke auf die NS-Zeit und ihre Aufarbeitung. Sie gehören auch einer Wissenschaftergeneration an, die sich von Projekt zu Projekt hantelt. Pragmatisierte Anstellungen an einer Universität gibt es heute nicht mehr. Nähert sich ein geschichtswissenschaftliches Projekt dem Ende, bewirbt man sich also für das nächste. Manche dieser Projekte sind finanziell besser ausgestattet, andere weniger. Das wirkt sich auch auf die Bezahlung der wissenschaftlichen Mitarbeiter aus. Begegnung mit dem Prekariat ist daher stets eine Möglichkeit, zwischen zwei Projekten kann es schon auch einmal sein, dass man sich mit der Arbeitslosen über ein paar Monate retten muss. Alle drei jungen Frauen haben sich nichtsdestotrotz der Wissenschaft – und dabei der Zeitgeschichte – verschrieben.
Wie sie zu dieser Disziplin gestoßen sind, ist dagegen höchst unterschiedlich: Vida Bakondy ist seit Kindheit an mit den Positionen der Kärntner Slowenen konfrontiert. Sie wuchs selbst im zweisprachigen Gebiet auf. In der Schule endete der Unterricht zur Geschichte der Kärntner Slowenen und zum Konflikt mit der deutschsprachigen Mehrheit allerdings mit der Volksabstimmung 1920 und dem sogenannten Abwehrkampf, das Museum Peršmanhof in Eisenkappel war auch kein Ziel von Exkursionen.
Winter kam in der Schule mit Zeitzeugen in Kontakt. Das hinterließ Eindruck. Ihr Großvater war NSDAP-Mitglied, was ihr aber erst nach und nach klar wurde, denn offen gesprochen wurde darüber nicht. Sie selbst vertrat ab dem Jugendalter linke Positionen. Ja, sie habe sicher durch ihre Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte auch einiges an Familiengeschichte abgearbeitet, sagt sie. Den Beleg, dass ihr Großvater ein Nazi war, hat sie erst, seit sie, bereits als Studentin, eine Abfrage in der Datenbank des Zeitgeschichte-Instituts machte. Der Großvater ist inzwischen verstorben. Aber mit ihrer Mutter spricht sie viel darüber, wie es war, als Tochter eines Täters aufzuwachsen.
Heinrich ist in Salzburg groß geworden, besuchte dort eine katholische Mädchenschule. Von Anfang an interessierten sie in ihrem Studium feministische Positionen. Über ihr Engagement in LGBT-Zusammenhängen stieß sie schließlich auf ihre erinnerungspolitischen Forschungsfragen. ◗
Bilder: © Daniel Shaked