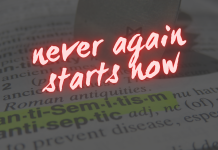Vereinslokal des wiederbelebten Salon Vienna ist das Café Korb. Präsent war dieses in Form seiner bunten Speisekarten auf Sesseln, Sofas, Beistelltischchen, in welche die Salonnières und Salonniers Yuval Katz, Natasa Konopitzky, Judith Rabfogel-Scheer und Kidan Wohlmuth verschiedenste Zitate zum Ausstellen des Jüdischen geheftet hatten.
„Ich glaube, dass wir in Deutschland eben versuchen, das Jüdische oder das Deutsch-Jüdische zu universalisieren, und dadurch enteignen wir aber vielen jüdischen Menschen diesen Ort gewissermaßen, diesen Ort des Jüdischen. Dadurch entsteht so ein Durcheinander, wo es überhaupt nicht klar ist, wo fangen jüdische Perspektiven an, wo hören sie auf.“ (Sergej Lagodinski, Repräsentantenversammlung Jüdische Gemeinden in Berlin, 2020)
„Zwar findet man in vielen Häusern noch heute typisierende Darstellungen von ‚Jüdischsein‘ und ‚den Juden‘ sowie Präsentationen jüdischer Religion und Feste, die gegen zeitlichen Wandel resistent zu sein scheinen. Doch bewegt sich die Musealisierung des Jüdischen insgesamt weg von einer Leistungs- und Beitragsgeschichte, der Erzählung über prominente deutsche Juden, und einer exotisierenden Religionsgeschichte hin zur Darstellung von Wandel, Diskontinuitäten und Aufbrüchen.“ (Katrin Pieper, deutsch Historikerin und Ausstellungsmacherin, Jüdisches Museum Franken, 2007)
„Should a permanent exhibition demonstrate the contribution of the Jewish population to society as a whole or, rather, should it draw the visitor’s attention to conflicts created by the surrounding societies? Should Jewish museums present Jewish religious diversity, or should they demonstrate that Jews are ‚just like anybody else‘? In other words, should ‚otherness‘ or indistinguishability be emphasized?“ (Cilly Kugelmann, deutsch-israelische Historikerin, ehemalige Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin und Stellvertreterin des Direktors, 2016)
Jede Menge inhaltliche Verhandlungsmasse legten die Salon-Betreiber also vor – doch die Salon-Besucher und -Besucherinnen hatten ohnehin auch selbst jede Menge Fragen mitgebracht. Was die neue Museumsdirektorin aus all den Fragen für sich mitnimmt, habe ich sie nach der von Konopitzky moderierten Gesprächsrunde gefragt. „Die Erwartungshaltung, die mir heute entgegengekommen ist, und das finde ich sehr, sehr schön, ist, dass diese Vielzahl an jüdischen Identitäten auch im Museum, im Programm, in den Ausstellungen berücksichtigt werden sollen.“ Sie nehme aber auch den großen Wunsch mit, dass jüdisches Leben nichts (nur) Museales sei, sondern (auch) im Hier und Jetzt stattfinde.
Ausgiebig wurde Staudinger auch zur Thematisierung von Antisemitismus in jüdischen Museen befragt. „Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass wir nicht mehr darüber reden müsste, weil er nicht mehr da ist.“ Aber Antisemitismus sei etwas, was die Lebensrealität von Juden und Jüdinnen bestimme, nicht immer, aber immer wieder. „Warum sollte das nicht Thema sein? Das darf und muss doch auch ein Thema sein, das einem am Herzen liegt.“ Noch wichtiger als die Aufklärung über Antisemitismus sei ihr dabei aber die Vermittlung, wie es jenen gehe, die mit Antisemitismus konfrontiert seien. Mit dem erhobenen Zeigefinger erreiche man bei Jugendlichen oft nicht das, was man sich erhoffe. „Aber die Perspektive zu wechseln, zu sagen, wie geht es denn eigentlich euch damit?“, das biete die Chance, das Thema nicht nur auf einer abstrakten Ebene abzuhandeln, sondern auf tatsächliche Menschen zu beziehen. Das schaffe die Möglichkeit für Empathie und sei „wahrscheinlich der klügere Weg“.
Interesse zeigten die Salon-Teilnehmenden zudem dafür, wie es mit der Dauerausstellung im Museum weitergeht. Diese werde neu gestaltet, kündigte Staudinger an, einfach deshalb, weil es selbstverständlich sei, eine Dauerausstellung nach zehn Jahren zu erneuern. „Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, man stellt einmal etwas in ein Museum hinein und dann bleibt das so für immer. Und dann hat man sich gewundert, dass es die Leute irgendwann nicht mehr interessierte. Nur irgendwann fällt jede Darstellung aus der Zeit heraus. Und heute wartet man nicht mehr, bis eine Dauerausstellung komplett aus der Zeit gefallen ist, sondern gestaltet sie in regelmäßigen Abständen neu.“ Nicht vorgreifen wollte Staudinger dem Prozess dieser Neugestaltung, auch wenn sie selbst dazu schon viele Ideen habe. Für nicht zwingend nötig hält sie beispielsweise eine chronologische Erzählung.
Fazit: Jede neue Museumsführung bringt ihren ganze eigenen frischen Wind ins Haus. Und in den nächsten Jahren wird in der Dorotheergasse der Fokus wohl stärker als zuletzt auf gesellschaftspolitischen Fragen liegen.
Rabfogel-Scheer, die bereits den ursprünglichen Salon Vienna mitbegründete, freute sich im Anschluss über den gelungenen Dialog von jüdischen und nicht-jüdischen Gästen. Warum sei der Salon, der tatkräftig durch die IKG-Kultur unterstützt wird, eigentlich nach der Gründung 2009 nach ein paar Jahren eingeschlafen, wollte ich von ihr wissen. „Wir haben Kinder bekommen.“ Wie das Leben eben so spielt. Die Kinder sind nun alle schon ein Stück größer und da ist, auch nach der Veranstaltungsdürre der Pandemie-Jahre wieder das Verlangen nach Austausch und Kultur. Im Salon Vienna soll es nun wieder regelmäßig um jüdische Themen mit gesellschaftspolitischer Relevanz gehen. Zu Chanukka wolle man sich mit dem Thema „Wajehije Or“ („Und es ward Licht“) beschäftigen, dann allerdings nicht in Debattenform, sondern mit einer künstlerischen Umsetzung.