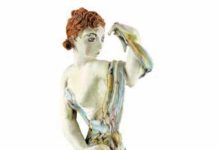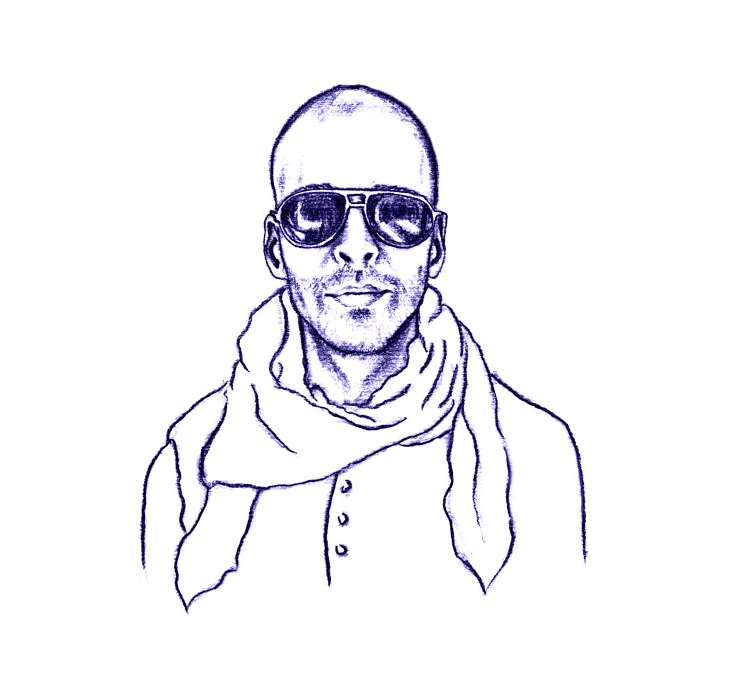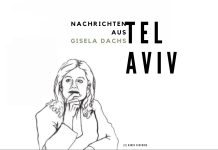Israels drittgrößte Universität, das Technion in Haifa, ist beispielhaft für die Umsetzung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in praktische, verkaufbare Produkte. Ihre Forscher haben immerhin 60 Hightechunternehmen gegründet. Text und Fotos: Reinhard Engel
Moshe Shoham ist am Technion in Haifa als Universitätsprofessor unter anderem für das Robotik-Labor am Institut für Maschinenbau verantwortlich. Auf den ersten Blick sieht seine Biografie ganz nach einer internationalen akademischen Karriere aus: Shoham hat unter anderem in Stanford und Columbia unterrichtet, er gehört mehreren akademischen Vereinigungen an und kann auf zahlreiche Ehrungen verweisen. Doch er hat noch ein anderes, praktischeres Leben. Shoham arbeitete schon in den 70er-Jahren eine Zeitlang für ein israelisches Industrieunternehmen, Israel Aircraft Industry. 2001 gründete er eine eigene Firma, Mazor Surgical Technologies, heute Mazor Robotics. Seit 2003 ist er neben seiner Universitätsarbeit dort Chief Technology Officer, also Technikvorstand.
Wissenschaftliche Erfindungen
Mazor gilt als eines der bekanntesten Hightechunternehmen, das in Israel aus einer Universität heraus entstand. Es notiert mittlerweile an der Tel Aviver Börse und an der New Yorker Nasdaq. Sein wichtigstes Produkt nennt sich Renaissance und ist ein roboterunterstütztes Führungssystem für Operationen an der Wirbelsäule, das dem Chirurgen präzises, minimal invasives Arbeiten erlaubt. 50 derartige Operationseinrichtungen konnte Mazor bisher international an großen Kliniken installieren, mit Hilfe von Renaissance wurden mittlerweile mehr als 35.000 heikle Operationen in Israel, Europa und den USA durchgeführt. Mazor ist allerdings kein Einzelfall – und auch nicht ganz zufällig entstanden. Denn an den großen israelischen Universitäten – wie auch am Weizmann-Institut – gibt es seit vielen Jahren sehr konkrete Programme, mit deren Hilfe wissenschaftliche Erfindungen in wirtschaftliche Nutzung umgesetzt werden sollen – und eben in erfolgreiche Unternehmen. Benjamin Soffer ist Geschäftsführer des T3-Programms am Technion, die Abkürzung steht für Technologie-Transfer-Technion, und seine Uni zählt immerhin 60 Unternehmen zu ihren Gründungen beziehungsweise Beteiligungen. Diese befinden sich in unterschiedlichen Stadien zwischen mühsamem Beginn und lukrativem internationalem Erfolg.
Russische Einwanderer
Soffer erzählt über die Anfänge von T3: „In den frühen 90er-Jahren hat es einen starken Zuzug russischer Einwanderer gegeben, viele von ihnen mit einer soliden wissenschaftlichen Ausbildung. Das war ein gewaltiger Gewinn an Humankapital für das Land, und dieses wollten wir nutzen.“ Das Technion zählt mit 550 Forschern international nicht zu den ganz großen technischen Hochschulen, diese bearbeiten aber ein breites Spektrum an Gebieten, von Mathematik über Physik, von IT bis zu Maschinenbau und Life Sciences. Die Frage war, wie man die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft so gestalten könne, dass die ökonomischen Erfolge die Forschungstätigkeit nicht einschränken.
Soffer: „In der internationalen akademischen Welt gilt heute das Prinzip ‚publish or perish‘, also: Publiziere, oder du gehst unter. Das heißt also, wir dürfen auf keinen Fall mit wirtschaftlichen Projekten die Professoren daran hindern, an ihren wissenschaftlichen Publikationen zu arbeiten.“ Dies gelte umso mehr, als sich ja diese Akademiker bewusst für eine Karriere an der Universität entschieden haben und eben nicht bei Intel, Siemens oder Microsoft an marktnahen Problemen feilen wollen. Aber es sei ganz entscheidend, eben aus der Forschung entstehende Innovationen daraufhin zu untersuchen, ob es für sie Möglichkeiten der wirtschaftlichen Umsetzung ergeben. Dafür hat das Technion eigene Kommissionen eingesetzt, die in mehreren Runden untersuchen, was sich für die – sehr teure – internationale Patentierung eignen könnte, auf welchen Patenten sich dann auch Firmen aufbauen ließen.
„Es stellt sich erst im Gefecht heraus, wer unter Beschuss kühl bleibt und nicht den Kopf einzieht. Das gilt auch für neu gegründete Unternehmen.“ Benjamin Soffer
„Sobald diese Entscheidungen gefallen sind, suchen wir für jede Innovation, für jedes mögliche Produkt einen eigenen Unternehmer von außen“, erklärt Soffer. „Wir wollen ja nicht, dass aus einem brillanten Wissenschaftler ein mittelmäßiger Unternehmer wird. Er soll sich weiterhin auf die Technologie konzentrieren, die Probleme mit Firmengründung, Finanzierung und Marketing sollen andere übernehmen.“ Und diese sind gewaltig. Soffer bemüht ein militärisches Bild: „Es stellt sich erst im Gefecht heraus, wer unter Beschuss kühl bleibt und nicht den Kopf einzieht. Das gilt auch für neu gegründete Unternehmen. Dafür braucht es äußerst belastungsfähige Typen.“

Zwar gibt es in Israel ein sehr breites, gut funktionierendes Biotop von Risikokapitalfirmen, und auch aus den USA strömt schon seit Jahren stetig Venture Capital ins Land. Laut Soffer sind die neu gegründeten Unifirmen dafür noch zu klein oder zu unsicher. „Man muss sie also über die ersten 18 bis 24 Monate drüber bringen, mit Unterstützung der Uni und mit Geld von Business Angels.“ Wenn diese schwierige Phase überstanden ist, fließt auch das Geld von den Investoren. So konnten Technion-Gründungen in den letzten drei Jahren immerhin 160 Mio. Dollar an Kapital akquirieren.
Das Einrichten dieses komplexen Prozesses scheint den Technion-Managern bisher ganz gut gelungen zu sein. Die Rate der nach sechs Jahren überlebenden Unternehmen liegt bei über 70 Prozent, das ist international gesehen ein ausgezeichneter Wert. Die Universität verdient dann an den erfolgreichen Firmen – entweder über Lizenzen und Patentgebühren oder beim Verkauf ihrer Anteile, wenn ein Großer übernimmt. „Das ist gerade heute besonders wichtig“, erklärt Soffer, „denn in Israel wie auch anderswo zeigen sich die staatlichen Budgetprobleme an den Dotierungen der Universitäten. Diese müssen einen immer größeren Teil ihrer Kosten selbst verdienen.“
Technologiebedürfnisse
Der Aufbau eigener, zunächst kleiner Unternehmen ist freilich nicht die einzige Schnittstelle der technischen Universität von Haifa nach außen. Ebenso wichtig sind laufende Kontakte mit anderen Universitäten, aber auch mit global agierenden Industrieunternehmen. Alex Gordon leitet das so genannte Liaison Office des Technion, und der studierte Agronom sieht sich als „interner und externer Verkäufer“: „Es würde keinen Sinn machen, wenn wir uns mit einer wissenschaftlichen Innovation an den Vorstand von Siemens wenden. Wir müssen genau das besessene Ingenieursteam im Konzern finden, dem unsere Forschungen weiterhelfen können.“ Also besucht man internationale Kongresse und Arbeitstagungen, „und dort finden einander die Forscher, die zusammenpassen“ (Gordon). Die einschlägigen Unternehmen werden regelmäßig angefragt, an welchen ungelösten Problemen sie gerade arbeiten. „Wir übersetzen dann die Technologiebedürfnisse der Unternehmen in die Sprache unserer Forscher. Da kann es sich um Materialien handeln, um mathematische Modelle oder um Fragen der Beschaffung bestimmter Komponenten.“
Manche Forschungsergebnisse brauchen lange Jahre, bis sie ihren Weg in die Industrie und in die Märkte finden, länger als einzelne Wissenschaftler in ihren Labors stehen. Gordon: „Wir arbeiten gerade an mehreren solchen Umsetzungen, wo die Professoren schon emeritiert sind. Aber erst jetzt scheint uns die Zeit reif, das zu vermarkten.“
Manchmal kommt die Anerkennung aber doch etwas früher, freilich auch Jahre nach der eigentlichen Forschungsarbeit. Im letzten Sommer erhielt Moshe Shoham, der Gründer von Mazor Robotics, für seinen Mini-OP-Roboter einen der höchsten amerikanischen Wissenschaftspreise im Technikbereich: den Thomas A. Edison Patent Award der American Society of Mechanical Engineers. Da war das Unternehmen auch schon zwölf Jahre alt und die entscheidenden wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür noch einiges älter.
Die Vielfalt der am Technion gegründeten Unternehmen ist erstaunlich.
Ein paar Beispiele:
Elminda befasst sich mit Gehirndiagnosen zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen.
SLP widmet sich der Entwicklung von Sensoren für Schlaflabors.
Rcadia entwickelt Diagnosesoftware für lebensbedrohende Notfälle.
Argo Medical Technologies bietet motorisierte Beinstützen für Gehbehinderte an, die diesen den Rollstuhl ersparen können.
MedicVision befasst sich mit komplexer Bildbearbeitung bei CT-Verfahren, um die Untersuchungen kürzer und weniger belastend zu gestalten.
Cellaris entwickelt hoch-hitzebeständige keramische Schäume zur Isolierung von Industrieöfen.
Innowattech erzeugt aus der mechanischen Energie von darüberfahrenden Autos oder Zügen piezoelektrisch „grünen“ Strom.
Nano Spun und Advanced Mem Tech entwickeln feinste Membranen zur Filterung von
Trink- und Abwasser.