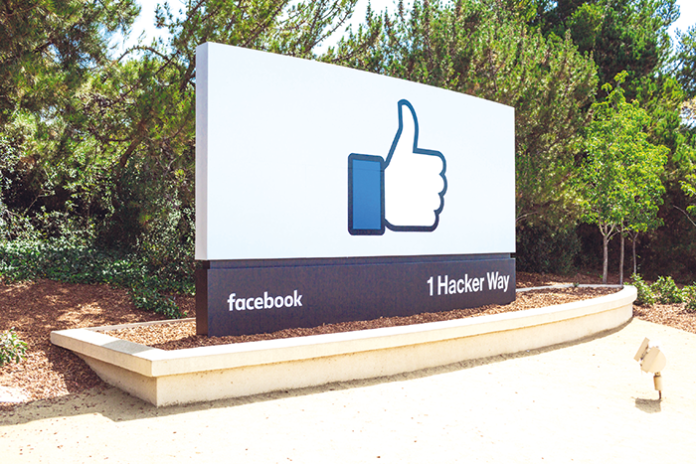Wina: Ihr Vortrag bei der MIT-Konferenz hier in Wien hatte den Titel Das Ende des Vertrauens. Was bedeutet dieser Satz? Welches Vertrauen gibt es nicht mehr? Das in die Politik oder auch das in die Medien?
Ethan Zuckerman: Wenn ich davon spreche, meine ich das Ende eines sehr speziellen Vertrauens, des Vertrauens in Institutionen. Mit Institutionen wiederum meine ich alles, das groß genug ist, nach bestimmten Regeln funktioniert, also wo man es mit Regeln als Gegenüber zu tun hat, nicht mit einem individuellen Gesicht. Institutionen sind etwa große Unternehmen, Universitäten, Banken, Kirchen, Gesundheitseinrichtungen und sicher die Regierung. Und auch meist die Medien. Das muss sich nicht unbedingt auf einzelne Journalisten oder Reporter beziehen. Selbst in großen Nachrichtenunternehmen werden einzelne Journalisten noch als Individuen wahrgenommen, nicht als Vertreter der Institution. Aber insgesamt gilt als Schlüssel: Wir verlieren den Glauben, das Vertrauen in die Institutionen, und zwar radikal.
Es hat schon vor Jahrzehnten eine radikale Kritik an den Institutionen gegeben, damals von der Linken, in Europa und in Amerika. Heute kommt diese grundsätzliche Kritik eher von der rechten politischen Seite, ob das jetzt die Kritik von Donald Trump ist oder die Brexit-Kampagne in Großbritannien. Wie erklären Sie das?
❙ Gute Frage. Ich denke, die Institutionen sind vor allem mit Themen wie den öffentlichen Gütern verbunden. Es geht darum, öffentliche Leistungen an eine große Zahl von Bürgern auszuschütten, dass nicht jeder für sich selbst sorgen muss. Das galt lange als linke Position, aber die Positionen von Links und Rechts haben sich auch verändert. Vor 30 Jahren hat die Linke etwa Staatsbetriebe gefordert, heute verlangen sie nur mehr das Aufrechterhalten öffentlicher Infrastruktur. Die Rechte hat sich auf eine verrückte Ideologie des freien Marktes festgelegt. Sie meinen, der Staat müsse sich nicht einmal mehr um die Infrastruktur kümmern, auch das könne man den großen Unternehmen überlassen und privat organisieren. In den USA gilt übrigens das Militär als eine der wenigen Institutionen, der noch vertraut wird. Das ist schon eine sehr seltsame Entwicklung und zeigt auch, wie sehr sich das politische Feld in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat.
»Einer meiner Kollegen am MIT und ich
studierten etwa,wie sich Menschen
im Web radikalisieren.«
Sie meinen also, diese Veränderung, der Vertrauensverlust, geht viel weiter zurück, als es die so genannten sozialen Medien gibt, die viele dafür verantwortlich machen?
❙ Ich bin da persönlich in einer defensiven Position. Mein erstes Unternehmen war eines aus dem Bereich der sozialen Medien. Wir haben es Menschen damals ermöglicht, erstmals ihre eigenen persönlichen Websites ins Netz zu stellen. Wir waren damit eine der frühesten Firmen, die das ermöglicht haben, was man heute „user generated content“ nennt. Ich denke, dass wir den sozialen Medien viel vorwerfen können, aber diese politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, von denen ich gesprochen habe, gehen viel weiter zurück, zumindest bis in die späten 1960er-Jahre. Meine Generation, die am Aufbau des Internets beteiligt war, befand sich schon inmitten dieses Vertrauensschwunds. Die sozialen Medien dürften das noch beschleunigt haben.
Aber sie haben die Entwicklung nicht erzeugt?
❙ Sie haben sie nicht geschaffen.
Soziale Medien sind Janus-köpfig. Auf der einen Seite ermächtigen sie Menschen, die zuvor keine politische Stimme hatten. Auf der anderen Seite ermöglichen sie zynischen Populisten, ihre Propaganda und ihre „Fake News“ zu verbreiten. Blogs können intelligent und kritisch sein, aber auch dumm und hasserfüllt, denken wir nur an den Antisemitismus im Web. Sehen Sie eine Möglichkeit, das auf zivilisierte Weise zu kontrollieren?
❙ Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass uns Kontrolle hilft, durch diese Landschaft zu navigieren. Wir sollten uns nicht auf schlechte, intransparente Kontrollen verlassen. Einer meiner Kollegen am MIT und ich studierten etwa, wie sich Menschen im Web radikalisieren. Schauen wir uns einmal das Attentat in Neuseeland an: Der Attentäter hatte in seinem Manifest bestimmte Worte und Phrasen. Und diese sind eher ungewöhnlich.
Sie meinen „Great Replacement“, den großen Austausch? Diese Schlüsselbegriffe kennen wir auch hier in der rechten Szene.
❙ Bleiben wir bei dem Wort Schlüssel. Genau dazu dienen diese Begriffe, nämlich, um eine geheime Tür aufzusperren. Wenn man also Begriffe wie „Great Replacement“ oder „White Genozide“ verwendet, dann weiß man genau, dass niemand, der nicht extrem ist, diese Ausdrücke verwendet. Das ist etwa eine Schwäche von Google, das nicht zu erkennen. Und was man beim Suchen über diese Ausdrücke erfährt, ist wiederum gefärbt, einschlägig gefärbt. Der Attentäter wollte auch, dass andere Menschen im Web genau diese Begriffe suchen, das sind die Wege zur Radikalisierung, die ihn selbst radikalisierten.
»Ich denke, facebook ist aus einer Reihe
von Gründen kein sehr gesundes Umfeld.«
Und er will wiederum andere auf diesen Pfad führen?
❙ Sein Morden und sein Video über diese Morde dienten der Rekrutierung von neuen Extremisten. Und auch, was er alles auf seine Waffen geschrieben hatte, forderte die Zuseherinnen und Zuseher auf, genau nach diesen Begriffen zu suchen. Das funktioniert natürlich nur, indem Google und YouTube so funktionieren wie sie funktionieren.
Was meinen Sie damit?
❙ Wenn man auf YouTube bestimmte Sachen sucht, scheint es einen stets in Richtung immer extremerer Ausprägungen zu führen. Man sucht etwa Informationen über den Klimawandel, und sehr schnell ist man in der Umgebung derer, die den Klimawandel negieren.
Weil diese sozialen Medien so viele Klicks wie möglich erzielen wollen?
❙ Weil eben kontroversielle Inhalte mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Wir haben etwa gerade in Columbia Journalisms Review eine Studie veröffentlicht, in der wir 6.000 Artikel analysiert haben, die in der Woche nach dem Massaker von Neuseeland erschienen sind. Und wir haben untersucht, welche dieser Artikel auf Facebook am häufigsten geteilt wurden. Es waren jene Artikel, die den Namen des Attentäters enthielten – und auch seine Ideologie. Das war verstörend, denn hier wurden Inhalte geteilt, die wir eigentlich nicht teilen sollten.
Und wo sehen Sie Möglichkeiten, dem entgegenzutreten?
❙ Ich weiß trotz allem nicht, ob wir uns mit Kontrollen aus diesem Problem herausregulieren können. Viele Menschen suchen das und wollen das. Was wir aber tun könnten, wäre, Alternativen anzubieten. Alternative Räume im Web anzubieten. Ich denke, Facebook ist aus einer Reihe von Gründen kein sehr gesundes Umfeld. Aber was mich ebenso ärgert, ist, dass es derzeit keine tragfähigen Alternativen zu Facebook im Web gibt.

Social Media. »Was mich ebenso ärgert, ist, dass es derzeit keine tragfähigen Alternativen
zu Facebook im Web gibt.«
Gibt es die nicht einmal in Ansätzen?
❙ Wir arbeiten daran. Wir denken dabei an virtuelle Gemeinschaften für bestimmte Regionen, für politische Debatten.
Sie meinen jetzt nicht jene Blasen, in die sich sowohl Rechte wie auch Linke zurückgezogen haben, ohne einander noch zu begegnen?
❙ Blasen sind etwas Natürliches, man muss auch nicht jeden am selben Ort treffen. Wichtig ist, dass es unterschiedliche Orte für unterschiedliche Debatten gibt. Wir haben unterschiedliche Debatten im Hörsaal, im Kaffeehaus, im Schlafzimmer. Wir brauchen das ebenfalls online: unterschiedliche Plattformen und Debatten, auch mit unterschiedlichen Regeln. Ich stellte mir eine Welt vor mit Tausenden von Plattformen für unterschiedliche Zwecke.
Meinen Sie dabei kommerzielle oder öffentliche Plattformen?
❙ Sie können durchaus privatwirtschaftlich organisiert sein, sie können von der Regierung subventioniert sein oder von Bürgerinnen und Bürgern getragen. Ich würde von diesen Plattformen drei Regeln verlangen: Sie müssen öffentlich im Geist sein, pluralistisch im Zweck – ein Raum soll nicht allen Zwecken dienen –, und sie sollen partizipatorisch sein, also offen für Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Wie unterscheidet sich das dann von Facebook heute?
❙ Facebook ist heute sowohl die Plattform wie auch die Polizei dazu.
Und profitiert noch von den Daten seiner Nutzer.
❙ Genau. Aber es geht vor allem darum, dass wir selbst die Polizei sein sollten. Wir müssen unsere eigenen Kontrollen entwickeln, uns diesen Aufgaben auch stellen. Es ist doch verrückt, dass Ihre Debatten in Österreich von Facebook-Angestellten auf den Philippinen kontrolliert werden, die entscheiden sollen: Das ist ok, das ist nicht ok. Das ist keine gesunde Art, Debatten zu führen. Wir brauchen dafür Verantwortlichkeit.
Wenn Sie an der Organisation dieser Verantwortlichkeiten arbeiten, haben Sie bereits ein konkretes Ergebnis, das Sie nennen können?
❙ Derzeit habe ich auf meinem Mobiltelefon eine App für Facebook, eine für Twitter, das sind zwei getrennte Universen. In meiner idealen Welt haben Sie einen gemeinsamen Browser für die sozialen Medien. Der liest etwa Facebook, Twitter und vielleicht auch Vienna Net. Vielleicht liest er auch ein Netzwerk für Diabetiker, wie ich einer bin. Ich sehe alle diese sozialen Netze an einem Ort. Jede Gemeinschaft im Web hat unterschiedliche Debatten und Regeln, aber ich kann sie alle an einem Ort erreichen. Wir haben begonnen, so einen Browser zu bauen. Er heißt gobo.social.
Das ist jetzt also nicht mehr unter dem Dach des Größten, Facebook, organisiert, sondern quasi daneben. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie Facebook auch nicht abschaffen, sondern seine Macht nur durch größere Vielfalt beschneiden.
❙ Ich möchte einfach so viele Menschen wir möglich sehen, die mit unterschiedlichen Netzen für unterschiedliche Zwecke experimentieren. Lassen Sie mich das am Beispiel LinkedIn erklären. LinkedIn bietet ganz ähnliche Funktionen wie Facebook, aber es hat eine völlig andere Dynamik, einen bestimmten Zweck: Es ist der Ort, an dem man seinen nächsten Job findet.
Es ist fokussiert und hat ein klares Ziel.
❙ Es ist fokussiert, es hat andere Regeln, und niemand würde dort in einen politischen Streit geraten. Sein Software-Code ist dabei nicht grundlegend anders als jener von Facebook. Es wäre jetzt noch sehr schwierig, ein komplett neues Netzwerk wie Facebook zu gründen, denn niemand würde kommen. Ich möchte nicht, dass jemand Facebook verlassen muss, auch ich will dort weiter meine Freude aus der Highschool treffen, die anderswo wohnen. Aber ich möchte dort keine politischen Diskussionen führen. Und ich möchte dort schon gar nicht über meine Gesundheit reden. Dafür hätte ich gerne eine andere Community mit deutlich strengeren Regeln, was Privatheit angeht.