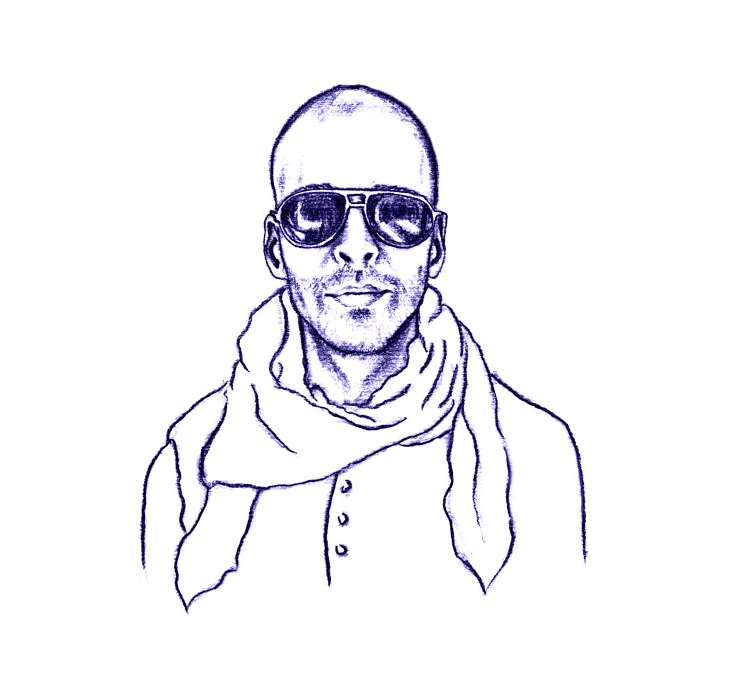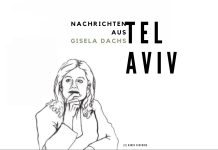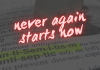Wien wird nicht die letzte Station im Leben von David Braunstein sein. Für ein paar Jahre will der gebürtige Deutsche aber sicher noch bleiben – zumindest bis er sein Philosophie-Doktorat in der Tasche hat. Von Alexia Weiss
In meiner Familie wird viel gereist“, sagt David Braunstein, oder Dave, wie er von Freunden genannt wird. Sein Vater kommt aus Manhattan, in Deutschland lernte er Braunsteins Mutter kennen – und blieb. Seine Schwester arbeitet heute in Dublin. Die Familie – Braunstein kam 1988 zur Welt – lebte zunächst in der Nähe Stuttgarts und zog dann nach Büßlingen, einen kleinen Ort an der Grenze zur Schweiz. So wuchs er zeit seines Lebens als einziger jüdischer Bub in seinem Umfeld auf – beziehungsweise wurde als solcher erzogen. Gerne erinnert er sich an die jüdischen Feriencamps in Deutschland, der Schweiz, England, Holland – im Sommer und im Winter. Sonntags ging er zum Religionsunterricht. Da seine Mutter keine Jüdin ist, musste Braunstein allerdings zum Judentum übertreten: Das Rabbinatsgericht tagte kurz vor seiner Bar Mitzwa. Es war ein liberaler Übertritt. In Wien ist er seit einigen Jahren Mitglied der Reformgemeinde Or Chadasch.

nur in Sommer- und Wintercamps.
Am Land als Jude groß zu werden, war von einem Gefühl des Andersseins geprägt, erzählt Braunstein heute. Was nicht immer etwas Negatives bedeuten müsse. „Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass es auch eine Verbindung schafft, denn die andere Person interessiert sich dann dafür, was Jude sein bedeutet. Aber es bringt eben auch Distanz mit sich – weil man mit Unbekanntem konfrontiert ist.“ Im Geschichtsunterricht sei er immer, wenn es um die NS-Zeit gegangen sei, gefragt worden, ob er auch noch etwas dazu sagen wolle. „Das ist einerseits sehr zuvorkommend. Andererseits fühlt man sich dadurch immer anders. Man könnte auch sagen: Wie man es macht, ist es falsch.“
Nach dem Abitur zog es Braunstein nach Israel, wo er zuvor noch nicht gewesen war. In der Nähe von Netanja absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr – und lernte dort nicht nur modernes Hebräisch (zuvor kannte er nur Gebetshebräisch), sondern viel über die israelische Gesellschaft. Im staatlich geführten Internat, in dem man sich bemüht, schwer erziehbare, sozial schwache Schüler aus ganz Israel bis zu einem Bildungsabschluss zu begleiten, war er für eine Gruppe von 15 Jugendlichen verantwortlich. Konfrontiert war er mit zwei rivalisierenden Gruppen: Jugendliche äthio-pischen Ursprungs litten unter der Diskriminierung durch Gleichaltrige mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion.
„Am Land als Jude groß zu werden, war von einem Gefühl des Anderssein geprägt.“
„Die Russen zeigten viel Nationalstolz, den sie von ihren Eltern mitbekommen hatten, und pflegten im Hebräischen den russischen Akzent. Die Äthiopier sprachen Amharisch, allerdings nur, wenn sie unter sich waren, weil sie sich sonst in der Gegenwart anderer minderwertig fühlten, und kein schlechteres Hebräisch als die Russen sprechen wollten.“ Mit Sport schaffte es Braunstein schließlich, dass die beiden Gruppen miteinander kommunizierten. In der Schule des Dorfes half er – als Deutschamerikaner – vor allem beim Englischunterricht.
Zahlreiche Interessen
Zum Studieren wollte er wieder zurück nach Europa – allerdings doch auch ein Stück weit weg von Büßlingen. Sein bester Freund, den er oft und gerne besucht hatte, stammt aus Wien. Und so war die Wahl rasch getroffen. Sein Diplompsychologiestudium hat er bereits beendet – und arbeitet seit diesem Herbst für das Unternehmen point of mind im Bereich Wirtschaftspsychologie. Von Beginn an schlug sein Herz allerdings für die Philosophie: Dieses Studium – in Kürze wird er den Bachelor absolvieren – möchte er bis zum Doktoratsabschluss fortsetzen und danach wissenschaftlich tätig sein.
Besonders fasziniert ist er von der modernen Systemtheorie von Niklas Luhmann. Die Gesellschaft wird dabei als ein umfassendes soziales System erklärt, das alle anderen sozialen Systeme in sich einschließt. Wenn es die Möglichkeit gibt, in Wien in diesem Bereich wissenschaftlich tätig zu sein, würde ihn das freuen. Wenn er dazu an eine andere Universität im deutschsprachigen Raum gehen müsste, wäre das aber auch in Ordnung.
Bis dahin genießt er Wien – sehr oft gemeinsam mit anderen Wiener Juden im Rahmen der Jüdischen Österreichischen HochschülerInnen, zu denen er 2010 gestoßen und in deren Vorstand er heute tätig ist. Aber manchmal setzt er sich auch einfach hin und komponiert. Als Hobby schreibt er Instrumentals in den Bereichen Hip-Hop und elektronische Musik, etwa für das Label Thron Studios. ◗
David Braunstein, geb. 1988 in Böblingen bei Stuttgart als Sohn von Lehrern, der Vater US-amerikanischer Jude, die Mutter Deutsche. 1993 Umzug nach Büßlingen nahe der Grenze zur Schweiz. Vor der Bar Mitzwa Übertritt zum Judentum. Nach dem Abitur 2007 Freiwilliges Soziales Jahr in Israel. Im Anschluss Psychologiestudium an der Uni Wien. Derzeit bei point of mind im Bereich Wirtschaftspsychologie tätig, daneben Fortführung des Philosophiestudiums, das Braunstein gerne mit dem Doktorat abschließen würde, um danach wissenschaftlich tätig zu sein. Seit 2010 bei den Jüdischen Österreichischen HochschülerInnen (JÖH) engagiert, inzwischen Vorstandsmitglied.
Bild: © Daniel Shaked