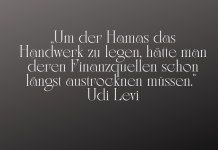Es ist kaum zu glauben, dass Stücke wie Dorothea Zeemanns Ende der 1960er-Jahre geschriebenes „Heimkehrerdrama“ Erbe bis heute unaufgeführt blieben. Ist man schon ein weniger ehrlicher (oder realistischer), ist es dann doch der logische Schluss einer Politik der Verweigerung, die eigene – nationale wie persönliche – Schuld einzugestehen. Zeemann – 1909 in Wien in kleinbürgerliche Verhältnisse geboren, 1993 als bald schon lange vergessene „ecrivaine autrichienne“ (Zeemann) gestorben – umkreist nichts weniger als die Politik der NS-Jahre mit ihren bis in die tiefsten Winkel zwischenmenschlicher, vor allem auch innerfamiliärer Beziehungen hineinreichenden Fangarmen nach 1945.
Ein Entrinnen scheint unmöglich – auch lange nach Kriegsende nicht. „sorgt mir, dass ich den hier nicht mehr hier sehe“, heißt es schon bald nach Beginn des Stücks, wenn der einstige „Ariseur“ dem Sohn des von ihm bestohlenen früheren Arbeitskollegen wiederbegegnet.
Weit über fünfzig Jahre nach seinem Entstehen wird Zeemanns knappes, umso schonungsloseres Werk nun am Theater Nestroyhof Hamakom in der Regie der Theaterleiterin Ingrid Lang uraufgeführt. Eine Notwendigkeit. Und eine Herausforderung, erzählt die Regisseurin, die WINA während der intensiven Probenwochen besuchen durfte.
„Vergessen“ oder doch verdrängt? Entdeckt wurde das Stück während Arbeit des Theaterteams über eine andere „vergessene“ österreichische Autorin der Zwischenkriegszeit, Maria Lazar, deren 1931 entstandenes Drama Der Nebel von Dybern letzten Herbst am Haus zur österreichischen Erstaufführung gelangte und einen weiteren wichtigen Baustein im „Wiedererinnern“ an die jüdische Schriftstellerin darstellt, die sich 1948 im schwedischen Exil das Leben nahm. Zeemann, eine Dekade jünger als Lazar und keine Jüdin, verlor durch die Shoah eine Reihe ihrer wichtigsten Lebensbegleiter, darunter ihren großen Mentor Egon Friedell. „Wer ist denn dieser Hitler gegen Egon Friedell?“, rief sie noch Jahrzehnte später dem toten Freund nach, den sie selbst 1938 nicht davon abhalten konnte, sich angesichts des sich Bahn brechenden mörderischen Regimes das Leben zu nehmen: „Der Teuerste will aus dem Leben scheiden, und ich habe nur banale Versicherungen der Verehrung und Wertschätzung dagegenzusetzen und meine eigene Fassungslosigkeit: […] Wer bin ich, dass ich einem derart Hervorragenden gut zurede auszureisen? Wie seine Argumente zerstreuen? Er fühlt solidarisch mit den Verfolgten, er gehört zu ihnen und will keinen Vorteil“, schrieb sie 1985 in ihrer autobiografischen Skizze When the Saints.
„Alfons bleiben am Ende von seiner Heimat nur seine Bücher.
Nur die nimmt er mit in die erneute Emigration.“
Ingrid Lang
„Wir hatten uns schon länger mit Maria Lazar auseinandergesetzt und mit anderen österreichischen Autorinnen ihrer Zeit, die – wohl auch aufgrund ihres Geschlechts – nicht so wahrgenommen wurden wie ihre männlichen Kollegen. Im Zuge unserer Recherchen zu weiteren Autorinnen der Zwischen- und Nachkriegszeit sind wir so auch auf Dorothea Zeemann gestoßen, und als der Dramaturg der Lazar-Inszenierung, der auch für den Sessler Verlag tätig ist, uns das Stück Erbe vorgeschlagen hat, war mir rasch klar, dass es sehr gut in das Programm des Hamakom passt“, erzählt Ingrid Lang überihre Entscheidung, Zeemanns Stück selbst in dieser Spielzeit zu inszenieren.
„heute wird es gemütlich.“ Dorothea Zeemann erzählt darin die Geschichte eines „arisierten“ Mehrparteienhauses in Wien. Dessen frühere Eigentümer, eine jüdische Familie, haben zwar die Shoah überlebt. Das Haus jedoch ging an einen einstigen Freund des Vaters über, der dieses wohl 1938 auf „legalem“ Wege, das heißt de facto durch die Bezahlung eines minimalen Kaufbetrags, übernommen – und darüber hinaus auch den Lehrstuhl des jüdischen Emigranten „an sich gerissen hat“, skizziert Lang die Prämisse für die folgenden drei pointierten Akte. Lang: „Das Stück setzt ein, als der Sohn des einstigen Professors, Alfons Adler, 1945 nach Wien zurückkommt – als amerikanischer Besatzungssoldat und damit als einer von jenen, die aktiv für die Befreiung seiner Heimat gekämpft haben.“ Während seine Eltern eine Rückkehr nach Wien verweigern, versucht Alfons, an alte Beziehungen anzuknüpfen, ohne dabei explizit Anspruch auf den einstigen Familienbesitz zu erheben. Hedwig, die älteste Tochter des „Ariseurs“ Prof. Dr. Reitknecht, einst die Jugendliebe von Alfons, ist nun verheiratet und Mutter eines bereits 1938 geborenen Buben, Otto. Schnell also hatte sie, erzählt das Geburtsjahr, „arischen Ersatz“ für ihren jüdischen Geliebten gefunden. Doch wo Alfons hofft, zumindest auf emotionaler Ebene an die Jahre vor dem „Anschluss“ anknüpfen zu können, stößt er ebenso auf die Kälte der Verdrängung der menschenverachtenden Taten seiner einstigen Nachbarn wie in seinem Bemühen, zumindest auf moralischer Ebene so etwas wie „Recht“ einfordern zu dürfen. Bereits zu Beginn, als Alfons erfreut seine zurückgelassenen Bücher wiederentdeckt, antwortet ihm die einstige Geliebte hart: „wir sind nicht sentimental, alfons.“ „Klar wird rasch“, erläutert Ingrid Lang, „dass eine Restitution offiziell auch nicht möglich wäre, hatte Reitknecht doch das Haus 1938 offiziell dem Kollegen ,abgekauft‘.“
In Erbe gelingt es Dorothea Zeemann, das ganze Spektrum des Verdrängens, Verschweigens und Verweigerns, des vermeintlichen Forderns und verzweifelten Suchens anhand einer Familie und ihrer Nachbar:innen zu verhandeln. Kaum jemandem gelingt es dabei, sich wirklich weiterzuentwickeln, man bleibt in starren Haltungen und vertritt einzementierte Positionen, bis Zeemann, so Lang, den Patriarchen „an seinem eigenen Hass ersticken lässt“. Während Millionen anderer verfolgt und ermordet wurden, starb, heißt es bitter noch auf der letzten Seite des Stücks, Reitknecht eines „natürlichen“ Todes – und als „Held“, der seine „Ideale konsequent verteidigte“.
Verödete Leben. Erbe umfasst eine Zeitspanne von 15 Jahren – mit den Eckdaten 1945, 1950 und 1960 – und endet damit, dass Alfons letztlich doch resigniert und erkennen muss, dass er in Wien, wo er aufwuchs, seine erste Liebe fand, seinen beruflichen Weg begann, jenes „Zuhause“, nach dem er über Jahre gesucht hat, nicht mehr finden wird. „Da ist ein Wiener. Er kommt heim. Und sein früheres Zuhause ist keines mehr. Am Schluss entscheidet Alfons, dass er wieder zurück – in die Emigration – geht, weil es einfach in seinem früheren Umfeld in Wien keine Menschlichkeit zu finden gibt“, resümiert Lang und zitiert eine der für sie besonders wichtigen Stellen, die in ihren Augen eine der Kernaussagen des Stücks darstellt: Auf die Frage im zweiten Teil von Erbe, der 1955, also nach der Staatsgründung, angesiedelt ist, was Alfons denn in Israel mache, antwortet dieser: „ich erziehe die jugend für den sport, weil der sport international ist, und ich arbeite wissenschaftlich, weil die wissenschaft über alle grenzen eine einzige ist, und ich sehne mich nachhause, weil das gefühl grenzen hat und ein zuhause braucht.“
„Ich habe letztens gelesen, man soll sich in die Zukunft rückwärts bewegen, also mit Blick auf die Vergangenheit, auf die Geschichte, um sich wirklich weiterentwickeln zu können.“
Ingrid Lang
Es ist kein Zufall, dass Zeemann ihrem Protagonisten den Namen „Adler“ gibt – und sein Vorname deutlich an jenen von Alfred Adler anspielt. Wie sein Vater, Reitknecht und eben auch Alfred Adler ist auch Alfons Arzt geworden. Und wie Adler, der 1938 nach England emigrierte, ist auch Alfons „Optimist geblieben“, erklärt Lang. „Gerade Adlers Individualpsychologie geht davon aus, dass man lernen kann, dass man sich weiterentwickeln kann, dass es eine Hoffnung gibt, dass das Denken sich auch im Positiven verändern kann. Das ist die eine Möglichkeit: zu lernen aus der Krise. Die andere ist, dass man aus dem Minderwertigkeitsgefühl immer mehr nach Macht strebt.“ Diese beiden Aspekte greift Zeemann im Stück auf und macht sie durch ihre Figuren, so Lang weiter, greifbar: „Alfons bleibt bis zum bitteren Ende, an dem er letztlich doch resigniert, optimistisch. Als er zum Schluss dann doch für immer geht, heißt es: ,adieu hedwig, ich gehe wieder in die emigration.‘ Und doch gibt es diese eine Figur, die deutlich macht, dass es die Möglichkeit einer positiven Veränderung gibt. Und zwar ist das die Nachbarstochter Irmi. Irmis Vater war Nationalsozialist und beging Selbstmord. Irmi ist am Beginn des Stücks 17 Jahre alt, was deutlich macht, dass sie es mehr noch als Reitknechts jüngerer Enkel Otto schafft, sich von der von klein auf indoktrinierten Ideologie zu lösen und einen eigenen Weg zu finden, mit der Vergangenheit umzugehen. Diese Kraft gibt ihr die Kunst – und diese ist es auch, die es ihr schließlich ermöglicht, sich von ihrem ,Erbe‘ zu befreien.“
Geschrieben Ende der 1960-Jahre, klingen im Stück, nicht zuletzt auch in Form der von Zeemann gewählten zeittypischen Kleinschreibung, deutliche Anspielungen an die von der Autorin und zeitweisen Vorsitzenden des österreichischen PEN-Clubs bewunderte – und von ihr wohl auch als Erste so benannte – „Wiener Gruppe“ an, zu der neben Friedrich „Achi“ Achleitner und Konrad Bayer auch Gerhard Rühm gehörte, dem am 7. Mai ein eigener Abend gewidmet ist. Jene Gruppe junger österreichischer Autoren und Künstler, die, so Zeemann selbst in einem ihrer späteren Texte, auf ihre „höllisch stinkende“ Art die Hoffnung (wieder)gab, „dass es dort und da wieder zu keimen anfängt“.
Für Ingrid Lang war diese Tatsache Anlass, auch in ihrer Inszenierung, die Marie-Luise Lichtenthal (Bühne und Kostüm) auf einem brüchig gewordenen Bücherboden platziert, Aufbrüche auf ästhetischer Ebene darzustellen und „diese neue Kraft, um gegen den braunen Sumpf anzugehen“ durch den Einsatz von Fremdtexten, aber auch anhand zeitgenössischer musikalischer Mittel (Musik: Sixtus Preiss) spürbar zu machen.
Zeemanns zu Unrecht lange vergessenes Erbe liefert Fragen, die bis heute nichts an Brisanz verloren haben. Lang listet nur eine paar von ihnen auf, denen sich das Ensemble in der gemeinsamen intensiven Probenarbeit immer wieder stellte: „Wo ist denn die persönliche Schuld, das ist die zentrale Frage dieses Stücks. Fängt sie da an, wo man nicht im Widerstand war? Oder wo man nicht ,nein‘ gesagt hat. Oder da, wo man wirklich aktiv mitgemacht hat? Und wie ist das Erbe davon?“
Nicht zuletzt, ist sich Lang sicher, ist das Stück, das sie auch angesichts des Massakers des 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg ausgewählt hat, eine Möglichkeit, sich mit dem aktuellen Istzustand zu beschäftigen: „Denn klar wird, wenn Alfons am Ende – 15 Jahre nach Kriegsende und Israel seit 12 Jahren ein existierender Staat – sagt, er geht zurück in die Emigration, dass der Antisemitismus unverändert spürbar geblieben ist. Und das spüren wir auch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Entstehung von Erbe. Und man fragt sich: Wo geht er denn hin? Wo geht jemand nach dem 7. Oktober hin? Wo ist denn jetzt noch Heimat oder Zuhause? Alfred nimmt am Ende nur seine Bücher mit, sie sind sein Zuhause, seine Heimat. Dieses Bild hat mich angesichts der aktuellen Situation sehr berührt.“
Dorothea Zeemann:
Erbe
Uraufführung
Inszenierung: Ingrid Lang
11. April bis 9. Mai 2024, 20 Uhr
Bin ich frei – und fasse es nicht?
Podiumsgespräch über den Menschen und die Autorin Dorothea Zeemann
Mit Anna Baar und Franz Schuh
Moderation: Alexandra Millner
14. April 2024, 11 Uhr
Leben in Latenz.
Texte von Dorothea Zeemann
Lesung mit Veronika Glatzner und Mona Kospach; Zusammenstellung: Angela Heide
21. April 2024, 11 Uhr
ich suche blumen
im benzin
Von und mit Gerhard Rühm
7. Mai 2024, 19 Uhr
Theater Nestroyhof Hamakom Nestroyplatz 1, 1020 Wien hamakom.at