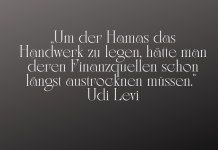Bis 19. August 2024 Staging Hofmannsthal Kuratiert von Christiane Mühlegger-Henhapel (Theatermuseum) und Katja Kaluga (Deutsches Hochstift Frankfurt am Main)
Theatermuseum Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien
theatermuseum.at
2024 gilt als eines jener „Jubiläumsjahre“, in denen man in Österreich kaum zur Ruhe kommt: 200. Geburtstag Anton Bruckners, 150. Arnold Schönbergs, 100. Todestag Franz Kafkas, 100. Wiederkehr der Eröffnung des Theaters in der Josefstadt in der Direktion Max Reinhardts, und selbst das „Strauss-Jahr“ 2025 weht schon mit einigem Aufsehen über den heimischen Kulturhimmel. Da scheint es fast still rund um das „Hofmannsthal-Jahr“, zumindest wenn es um den medialen Rummel geht. Hofmannsthal, der stille Grand Seigneur der österreichischen Theaterliteratur der Jahrhundertwende, ruft auch 95 Jahre nach seinem tragischen Tod nur zwei Tage nach dem Selbstmord seines Sohnes nicht lautstark nach Aufmerksamkeit. Wer sich dennoch intensiver mit dem psychologisch genauen Beobachter, feingliedrigen Dichter und haarscharfen Begleiter aller Umsetzungsprozesse seiner Werke beschäftigen will, ist im Theatermuseum genau richtig. Die nur auf den ersten Blick kleine Schau im Erdgeschoss des schönen Palais gegenüber der Albertina eröffnet geschickt eine ganze Bandbreite an Themen und Facetten aus dem umfangreichen Schaffen des Dichters, die anhand bekannterer, aber auch bislang kaum gezeigter Objekte aus den Sammlungen der beiden kooperierenden Institutionen immer wieder Neues und Überraschendes zutage bringen. Dabei bewegt sich die Ausstellung in einem „Prolog“ und drei „Akten“ entlang mehrerer ausgewählter Stationen – darunter Hofmannsthals Wiener Arbeitswohnung, die ersten Elektra- und Rosenkavalier-Inszenierungen und der Rosenkavalier-Stummfilm. Ein „Epilog“ lädt schließlich ein, sich anhand eines Plans selbst Hofmannsthals Wien zu ergehen.
Prolog: die „inszenierte“ Stadtwohnung. Hugo von Hofmannsthal wurde 1874 in Wien geboren und wuchs in der Wohnung seiner Eltern in der Salesianergasse 12 auf. Nach der Eheschließung mit der Bankierstochter Gertrud, „Gerty“, geborene Schlesinger, zog das Paar in eine Rodauner Barockvilla, das „Maria-Theresien-Schlössel“ (heute „Hofmannsthal-Schlössl“), das bis 1938 in Besitz der Familie blieb, ehe man es Gerty von Hofmannsthal auf dem „Arisierungsweg“ entzog. So schön das Anwesen – angemietet und voll möbliert – der Familie war, so beschwerlich war der tägliche Weg in die Wiener Innenstadt. 15 Jahre lang übernachtete Hofmannsthal daher, wenn er in dieser tätig war, vorwiegend in der elterlichen Wohnung.
„Für Hofmannsthal hatte der Raum, mit dem man sich umgab,
immer auch etwas mit der jeweiligen Persönlichkeit zu tun und
war nicht nur ,schmückend Beiwerk‘.“
Christiane Mühlegger-Henhapel
Als sein Vater 1915 stirbt, bricht das gewohnte Refugium für den damals bereits 40-jährigen Autor weg – wenige Monate später findet Hofmannsthal in einer kleinen Zweizimmerwohnung im Dachgeschoß der Stallburggasse 2 den erhofften Ersatz; die neue Adresse wird von nun an zu seinem Arbeits-, vor allem aber auch Repräsentationsort. Kuratorin Christiane Mühlegger-Henhapel: „Er hat dort Freunde begrüßt, auch Journalisten empfangen. Und auch in den Zeitungen wurde die Wohnung ausführlich besprochen.“
Vor der Türe liegt das Café „Bräunerhof“, das 1920 als „Café Sans Souci“ eröffnet, um die Ecke das Palais der Familie Eskeles – das heutige Jüdische Museum –, in dem sich seit 1895 die einflussreiche Wiener Galerie Miethke befindet, Graben, Stephansplatz und Michaelerplatz sind je eine Gehminute entfernt: ein zentraler Wiener „Rückzugsort“ des vielbeschäftigten Autors, der sich mit dem fünf Jahre jüngeren Oskar Strnad einen der namhaftesten Architekten der Zeit für die Inneneinrichtung holt, mit dem er auch schon am Theater gearbeitet hat. Und „Strnad macht jetzt etwas ganz Besonderes“, zeigt Mühlegger-Henhapel auf das ausgestellte Bildmaterial der dicht verbauten kleinen Wohnung. „Er drapiert die Wände mit Stoffbahnen, die wie Vorhänge über die gesamte Breite aller vier Wände des Hauptraumes gespannt werden können. Einen besonders theatralen Effekt hat diese Bespannung an den Türen und Fenstern, über die der Stoff ebenfalls gezogen, hier aber – wie ein Bühnenvorhang – gerafft wurde.“
Diese Art einer inszenierten Drapierung hatte mehrere Funktionen, darunter Wärmedämmung und Lärmschutz, diente aber auch dazu, den Raum möglichst vor allen äußeren Einflüssen sichtbar zu schützen und ihn so als Arbeitszimmer eines eminenten Dichters seiner Zeit sichtbar zu machen. In der Ausstellung sind mehrere Fotografien der Wohnung zu sehen, u. a. auch aus den Jahren vor Strnads innenarchitektonischer Intervention, noch ohne Bespannung. Gezeigt werden daneben auch weitere Innenraumgestaltungen Strnads für andere Auftraggeber:innen sowie vor allem dessen damalige Bühnenbilder, die deutliche Ähnlichkeiten mit den privaten Repräsentationsorten seiner Kund:innen aufweisen. Nachvollziehbar wird so, dass sowohl Theaterräume wie eben auch private Räume dem künstlerischen Zeitgeschmack gleichermaßen folgten. Für Strnad, erzählt Mühlegger-Henhapel, war es wichtig, dass der Wohnbereich „die Persönlichkeit seiner Auftraggeber:innen“ herausstrich; zugleich waren diese aber eben doch dem jeweiligen Geschmack ihrer Zeit verpflichtet. „Und sie konnten damals bereits aus zahlreichen historischen Stilen wählen und diese in ihren Lebensräumen auch zusammenführen“, ergänzt die renommierte Theaterhistorikerin. So finden sich neben barocken Anklängen auch Möbel der Jahrhundertwende in Hofmannsthals Arbeitswohnung wieder, zahlreiche Gemälde, mit denen er ganz bewusst seine Familiengeschichte für Besucher:innen arrangierte, aber auch ein großer chinesischer Teller, den Hofmannsthal in Berlin gekauft hatte und der in der Ausstellung sowohl auf den Bildern wie auch, perfekt erhalten, in einer Vitrine zu sehen ist. Eine Freundin Hofmannsthals berichtete anlässlich eines Besuchs davon, dass sie das Bett im Schlafzimmer an den Rosenkavalier erinnere; und der Journalist Arthur Ernst meinte, dass in den Räumen, die Strnad nach Hofmannsthals Wünschen gestaltet hatte, auch dessen „Schwieriger“ wohnen könnte. „Umso interessanter, als der ,Schwierige‘ ja tatsächlich in einem Palais in der Herrengasse lebt – dieses ist jedoch um ein Vielfaches größer und erlaubt es Hofmannsthals Protagonisten eben nicht, sich auch nur für einen Moment lang zurückzuziehen“, erläutert die erfahrene Kustodin des Museums.

und privater Weg führte an zahlreiche weitere Wiener Orte, die ebenfalls im Zentrum der Schau stehen. © Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt/M..; Nachlass Hofmannsthal
Künstlerische Symbiosen. Nicht nur in seinem Privatleben war Hugo von Hofmannsthal ein überaus genauer Begleiter aller Umsetzungsprozesse seiner Werke. Bereits 1903 folgte auf seine intensive Zusammenarbeit mit Max Reinhardt für die in Berlin uraufgeführte Elektra sein Text Die Bühne als Traumbild. Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie hier ästhetische Programmatik und theatrale Praxis auf das Engste einhergehen, und bringt sowohl fotografisches Material wie auch Bühnen- und Kostümentwürfe, die explizit auf dieses Wechselspiel hinweisen, das nicht zuletzt die ganz eigene Form der Zusammenarbeit der jeweiligen Künstlerpersönlichkeiten verdeutlicht. „So könnte es sein“, argumentiert die Kuratorin, „dass Hofmannsthal unter dem Eindruck der Regie Reinhardts seine Theorien entwickelte“. Eher jedoch gehe man in der Forschung „heute davon aus, dass sie gemeinsam an der Produktion arbeiteten und Hofmannsthal parallel dazu die entwickelten Gedanken verschriftlichte. Hofmannsthal beschäftigt sich auffallend viel und sehr intensiv mit Fragen der Umsetzung seiner Texte auf der Bühne, und er schreibt seine Thesen nieder. Was er nicht kann, ist jedoch, sie selbst für die Bühne umzusetzen. Hier sind seine wichtigen Wegbegleiter, zu denen neben Reinhardt auch Alfred Roller, Max Kruse oder eben Oskar Strnad zählen, von großer Bedeutung. Ihnen vertraute er, seine Visionen adäquat umzusetzen.“
Nicht immer funktionierten Umsetzungen: So musste etwa 1905 eine Neuinszenierung der Elektra mit Edward Gordon Craig abgebrochen werden, nachdem sich der englische Bühnenbildner und der Wiener Dichter zerstritten hatten. Wichtig war für Hofmannsthal in diesem Fall, erzählt Mühlegger-Henhapel, dass das Bühnenbild die psychische Verfasstheit der Protagonistin deutlich machen sollte.
„Vergessen wir doch niemals, dass die Bühne nichts ist,
und schlimmer als nichts, wenn sie nicht etwas Wundervolles ist.“
Hugo von Hofmannsthal
Erfolgreiche Franchiser. Als Richard Strauss die Elektra sieht, ist der Komponist, dessen Salome 1905 den künstlerischen Durchbruch bedeutet hatte, so begeistert, dass er den Plan schmiedet, das Stück zu vertonen. Strauss kontaktiert Hofmannsthal persönlich, um ihn zur Zusammenarbeit einzuladen. Es ist das erste einer Reihe gemeinsamer Projekte, die von nun an – und mit bis heute anhaltendem Welterfolg – die beiden sehr unterschiedlichen Künstler auf das Engste verbinden. Während Strauss sich im Falle dieser ersten Zusammenarbeit noch an den bereits existierenden Stücktext annähern muss, entstehen die folgenden Projekte, darunter Ariadne auf Naxos (UA 1912), Die Frau ohne Schatten (UA 1919), Arabella (UA 1933) und allen voran Der Rosenkavalier (UA 1911) immer im gemeinsamen Entwicklungsprozess zwischen Komponist und Librettist. Doch auch hier gelang, zumindest in den Augen des Perfektionisten Hofmannsthal, vor allem, wenn es um die Bühnengestaltung seiner Werke ging, nicht immer alles. So erinnerte er sich noch mehrere Jahre nach der Uraufführung der Oper Elektra an der Dresdner Semperoper 1909, dass, zitiert Mühlegger-Henhapel den frustrierten Librettisten, „alles, was dort geboten wurde, das Auge beleidigt“ habe. Die Wiener Inszenierung übernimmt Alfred Roller – auf Wunsch Hofmannsthals, der mit dem Bühnenbildner schon 1905 am Deutschen Theater Berlin anlässlich von Reinhardts Inszenierung von Ödipus und die Sphinx zusammengearbeitet hatte. Nach Mühlegger-Henhapel geht nun, in Wien, alles auf, was sich Hofmannsthal für die Umsetzung wünscht. „Meiner Meinung nach ist das Bühnenbild auch wirklich großartig gelungen: Liest man die szenischen Anmerkungen Hofmannsthals und schaut sich dann an, was Roller daraus gemacht hat, dann erkenne ich wirklich eine 1:1-Umsetzung; da hat jemand verstanden, was Hofmannsthal sich wünscht.“
Der Rosenkavalier in Schönbrunn. Die vom Architekturbüro Extraplan auch räumlich klug gestaltete Ausstellung, die durch den Einsatz von Vorhängen, Stellwänden und mobilen Schaukästen eine umfassende Darstellung an unterschiedlichsten Objekten ermöglicht, bietet Einblicke in eine Anzahl weiterer Vorhaben, die ähnliche Vorgehensweisen Hofmannsthals deutlich machen. Aber auch als weltgewandte „Franchiser“ reüssierte das erfolgreiche Künstlertrio in diesen Jahren – so wurden alle Entwürfe Rollers für Bühne wie Kostüme zur Rosenkavalier-Uraufführung gedruckt und – ähnlich heutigen globalen Unterhaltungsformaten – nachspielende Theater weltweit angehalten, sich an die Vorlagen zu halten. Ein Beispiel dafür findet sich auch in der Ausstellung: ein Kostüm von Jarmila Novotná als „Oktavian“, das diese 1940 nach ihrer Emigration in die USA an der New Yorker Metropoliten Opera trug. „Das Kostüm stammt von einem New Yorker Kostümatelier, ist aber bis in die kleinsten Details noch an die RollerEntwürfe von 1911 angelehnt“, erzählt die Kuratorin und hält fest, dass die Entwürfe bis heute „unser Bild des Rosenkavaliers beeinflussen“.

Selbst noch bei der filmischen Adaption des Stoffes erwies sich der Autor als moderner Visionär mit auch handwerklichen Fähigkeiten, die sich scheinbar leichtfüßig zwischen den damals neuesten Medien bewegten. So sind Aufzeichnungen erhalten, in denen Hofmannsthal auf mehreren Spalten die verschiedenen Ebenen – Text, Spiel, Kamera, Raum, Ausstattung – der filmischen Umsetzung darzustellen versuchte. Und es war auch Rollers „erste und einzige Arbeit für den Film“, weiß Mühlegger-Henhapel und erläutert weiter, dass sich der monumental besetzte Streifen zwar im Großen und Ganzen an die Bühnenvorlage hielt – der letzte Akt aber spielt im Film bei einem Maskenball in Schönbrunn. Und so fanden auch die Dreharbeiten in den Schlossanlagen selbst statt – darüber hinaus, wenn auch nur für eine kurze Sequenz, am Eingang der Parkanlagen von Schloss Belvedere. Und auch hier liefert die Schau wunderbares, kaum bekanntes Bildmaterial sowie Ausschnitte aus dem 2016 aufwendig restaurierten Film des 1938 im Pariser Exil verstorbenen expressionistischen Filmpioniers Robert Wiene. Die Uraufführung fand Anfang 1926 in Dresden statt, die Wiener Erstaufführung im Konzerthaus – mit eigens aufgezogener Leinwand und großem Orchester, das für die musikalische Begleitung des – letztlich wenig erfolgreichen – Monumentalstreifens auf die Originalpartitur von Strauss zurückgriff.
Epilog: Hofmannsthal im Stadtraum Wien. Gegen Ende der Ausstellung findet sich noch ein Wien-Plan, der entlang der Lebensorte Hofmannsthals zu einem persönlich zusammengestellten literarischen Spaziergang einlädt. Die gewählten Orte haben dabei, schließt die Kuratorin, sowohl biografische wie künstlerische Bezüge, verweisen auf Wohnorte ebenso wie wichtige berufliche Stationen in der Stadt. „Man kann vor allem durch den dritten und ersten Bezirk wandern, aber freilich auch bis hinaus nach Liesing“, lädt sie zur weiteren, sehr empfehlenswerten Auseinandersetzung mit dem am 15. Juli 1929 in Rodaun an den Folgen eines Schlaganfalls verstorbenen Dichter ein.