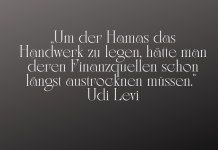Wie bewegen sich die Menschen durch das Denkmal?“, hat Irit Dekel die Aufsichtspersonen im Holocaust-Memorial in Berlin gefragt. „Nie gerade aus“, war die verblüffende Antwort. Jahre hat die israelische Wissenschaftlerin die Interaktionen der Besucher*innen beobachtet und erforscht, in Interviews mit Tour-Guides, Security-Leuten, deutschen und anderen Touristen die Gedächtnispraktiken analysiert und darüber publiziert.
Besucher*innen, so hat sie festgestellt, durchlaufen im wahrsten Wortsinn einen Prozess, sie versuchen durch das Erlebnis des Mahnmals eine moralische Veränderung an sich zu spüren, „die moralische Karriere der Besucher“, nennt Dekel dieses von ihr konstatierte Phänomen.
Um genau diese Fragen vor Ort zu untersuchen, hat die Israelin in New York zuerst einmal Deutsch studiert, eine Sprache, die ihr nur ganz entfernt durch die Großeltern, die aber meist jiddisch sprachen, noch im Ohr war. Mittlerweile lebt sie als „Migrantin“ gemeinsam mit ihrer Familie schon fast ein Jahrzehnt in Berlin und hat auch die dort anwachsende israelische Gemeinde bereits soziologisch beforscht.
„Man braucht Monumente als Denkanstoß.“
Irit Dekel
Instrumentalisiertes Gedenken. In der Gedenkkultur gibt es natürlich fundamentale Unterschiede zwischen Israel und Deutschland, also auf Opfer- und Täterseite, obwohl in beiden Ländern das Erinnern an die Schoah gleichsam zur Staatsräson gehört.
„In Israel erinnern wir uns ja ständig, und das ist mit Emotionen verbunden. Pessach, Holocaust- und Gefallenen-Gedenktag. Wenn man sich aber immer an Verfolgung und an die Opferrolle erinnert, so macht das Angst, und diese Angst führt zu einem Bestreben nach Stärkung und Sicherheit des Staates“, sieht Dekel die Gefahr der Instrumentalisierung des Holocausts für politische Ziele. „Seit den 50er- und 60er-Jahren hat sich die Funktion des Gedenkens verändert, heute wird es auch dazu missbraucht, Juden immer noch als mögliche Opfer darzustellen in einer nach rechts rückenden Gesellschaft.“ Gleichzeitig gäbe es aber in Israel eine „wunderbare Zivilgesellschaft“, die diesen Tendenzen widerstehe und auch Gegenrituale zu den großen staatstragenden Gedenkritualen, wie etwa im kleinen Rahmen „Sikaron ba Salon“, also im Wohnzimmer.
Rechtspopulisten in Europa manipulierten und instrumentalisierten den Holocaust hingegen für ihre Zwecke, Juden würden scheinbar geradezu geliebt, dieses Reinwaschen diene aber nur dazu, ihre rassistische Ideologie zu legitimieren, so Dekel.

hat in Tel Aviv und Amerika studiert und sich als Soziologin auf das Gebiet von Gedächtnis- und Erinnerungskultur spezialisiert. Zur Zeit ist sie als Fellow am Zentrum für Versöhnungsforschung in Jena tätig. Ihr Buch Meditation at the Holocaust Memorial in Berlin ist 2013 bei Palgarve Macmillan erschienen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin. © Dan Haimovich
Diskussionsbedarf. Erinnern kann ja kein Selbstzweck sein, daher die Frage, was dessen Aufrechterhaltung heutzutage noch bringen kann. „Ohne gesellschaftliche Diskussion bringt es gar nichts, denn demokratische Bildung funktioniert nicht mit Zwang, sondern nur mit Diskussion. Wenn wir die Orte der Erinnerung aber für weniger gebildete Menschen öffnen, auch für Migranten und Muslime und Gruppen, die darüber reden, dann schaffen wir etwas gemeinsam“, ist Dekel überzeugt.
Auch die Bedeutung mehr oder minder monumentaler Gedenkstätten wird ja zunehmend in Zweifel gezogen, doch da meint die Soziologin: „Man braucht Monumente ergänzend und als Denkanstoß, und wenn man das leugnet, könnte man fragen, was braucht man überhaupt? Das Denkmal für Sinti und Roma beim Deutschen Reichstag z. B. ist ein Bezugsort zur Erinnerung.“
Mit dem Verschwinden der letzten Zeitzeugen und dem wachsenden Antisemitismus „müssen wir uns neue Formen der Mediation überlegen. Welche Texte sind wichtig, welche Dokumente, welche Ideen von Gesellschaft produzieren wir? Denn wenn wir uns nur an tote Juden erinnern, aber die lebendigen nicht sehen, dann lernen wir nichts daraus.“