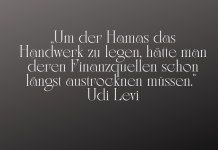Unter dem nationalsozialistischen Regime wurden die Juden aus Wien vertrieben und ermordet. Ihre enteigneten, im Land verbliebenen Besitztümer aber sorgten für eine stabile Grundlage im Nachkriegsösterreich. Was für die jüdische Gemeinschaft gilt, trifft in gleicher Weise auf die umgebende nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft zu. Österreich versteht sich bekanntlich gerne als Kulturgroßmacht, in aller Welt wird das Bild des imperialen Wien touristisch erfolgreich verkauft. Der Staat, das Land, die Stadt und ihre Bürger, sie alle leben vom kulturellen Erbe. Es ist ihre ökonomische Basis im zweifachen Sinn: Neben berühmten Schriftstellern, Nobelpreisträgern, der Wiener Medizinischen Schule, dem Wiener Kreis, dem Wien des Fin de Siècle, Ringstraße, Staatsoper und Musikverein spielen dabei die Enteignungen der NS-Zeit sowie die Nicht-Restitutionspraxis der Nachkriegszeit und der damit verbundene erfolgreiche Wiederaufbau des „Neuen Österreich“ eine ganz entscheidende Rolle. Die Verantwortung für das materielle Erbe der Vertriebenen und Ermordeten ist somit eine mehrfach geteilte: Bund, Land, Stadt, Kultusgemeinde, Bürgerinnen und Bürger sind gleichermaßen gefragt, wenn es darum geht, ihre Wurzeln: das verwaiste, heute gefährdete Kulturgut der Nachwelt zu erhalten.
Der Staat, das Land, die Stadt und ihre Bürger, sie alle leben vom kulturellen Erbe der jüdischen Gemeinschaft.
Der Stolz auf die Ringstraße und das imperiale Wien, die selbstverständliche Nutzung der modernen, im Zuge der Industriellen Revolution geschaffenen Infrastruktur, darunter Spitäler, Ausbildungsstätten, Versorgungsinstitute, prägen das Bild der Stadt – doch die Schöpfer all dessen sind vergessen. Das Wissen konnte verloren gehen, da die Macht der Nazi-Propaganda und Herrenmenschenideologie mit ihrer Strategie, Juden ihre Persönlichkeit zu nehmen, sich dauerhaft durchgesetzt hat. All dem zum Trotz, und erstaunlicherweise, ist die gänzliche Auslöschung nicht gelungen: Es gibt sie, die individuellen Denkmäler – für jede einzelne der vernichteten Familien. Jeder Grabstein ist ein Ort der Erinnerung, und ein kraftvolles Zeichen physischer Präsenz.
Die Denkmäler werden inzwischen von Dieben bedroht, aber auch von der Natur: Die Macht der Pflanzen erobert sich das von Menschen Geschaffene zurück. Allerdings verfügen wir über alle Möglichkeiten, diesem Untergang Einhalt zu gebieten, den Verfall zu verhindern und der Vergänglichkeit die Kraft der aktiven Erinnerung entgegenzusetzen. Das bedeutet in diesem Falle Denkmalschutz – die Bewahrung der Grabmonumente als unmittelbare, ursprüngliche Form des Denkmals.
Wurzeln sind es tatsächlich auf den Friedhöfen, die die gewollte, individuelle Erinnerung an die untergegangenen Familien zu zerstören drohen. Tonnenschwere Denkmäler werden vom Druck jahrzehntelang vernachlässigter Vegetation beiseitegeschoben und stürzen in sich zusammen. Sofortige Rettungsmaßnahmen unter Formulierung von Restaurierzielen, mittel- und langfristige gärtnerische Konzepte und qualitätvoller Einsatz, in einem Masterplan zur Sanierung und Erhaltung der Friedhöfe gebündelt, tun not, um die Würde der Gedächtnisorte wieder herzustellen. Sie für die kommenden Generationen zu bewahren, ist eine Investition – nicht nur in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Dies sollte beim Erstellen der Budgets nicht aus den Augen verloren werden.
In der ältesten Gräbergruppe am jüdischen Friedhof Währing stehen zwei marmorne Kenotaphe, altrömischen Monumenten nachempfunden, zwischen denen wild ausgesamt eine Esche himmelwärts strebt. Der Baum hat die beiden Steinkonstrukte bereits um mehr als einen halben Meter verschoben, die riesigen Platten drohen auf wertvolle Stecksteine aus dem 18. Jahrhundert zu stürzen. Dies sind die Zeugen der letzten Ruhestätten von Sigmund Samuel Edlem von Wertheimstein (1797–1854), auch er einer der Gründerväter der IKG Wien, und dessen Ehefrau Nanette Kohn (1800 – 1849). Als Großhändler und Direktor der österreichischen Nationalbank verfügte er über Möglichkeiten und Mittel, ein Siechenhaus einzurichten, und vor seinem Tod vergab er noch Legate in der Höhe von 16.000 Gulden österreichischer Währung für verschiedene Wohltätigkeitsanstalten. Da die Esche für Baumschnitt- und Fällungsmaßnahmen unzugänglich platziert ist – in dem dicht belegten Gräberfeld ist es nicht möglich, eine Hebebühne aufzustellen, ohne dabei wertvolle Steinsubstanz unwiederbringlich zu beschädigen, haben Steinrestauratoren vorgeschlagen, den Baum an seiner Stelle zu belassen und stattdessen die beiden Monumente zu versetzen. Der dazu nötige Raum ist in unmittelbarer Umgebung reichlich vorhanden, und die angrenzenden Grabdenkmäler wären damit ebenfalls vor der drohenden Zerstörung bewahrt. Die Kosten dafür liegen unter jenen der Baumbeseitigung.
Unmittelbar oberhalb der Wertheimstein’schen Unterschrift auf der Gründungsurkunde der IKG Wien ist jene des Juwelenhändlers Moses Koblenzer (1755 Mattersdorf, Ungarn – 1834 Wien) auszumachen. Sein Namensvetter, der Eisenstädter Judenrichter Moses Koblenzer (1712–1805), wurde unter einer prachtvollen torabandartigen traditionellen Steckstele bestattet. Sie ist unter dem Druck des darunter wurzelnden Baumes in zwei Hälften zerrissen, doch Stamm und Steinteile bilden eine Einheit im Gleichgewicht.
Veranstaltungen am jüdischen Friedhof Währing:
Freiwilligentage: 6.7., 14.9., 2.11. 2014
jeweils 11 bis 16 Uhr
Führungen: 19.10., 26.10., 9.11.2014
Anmeldung: Grüner Klub im Rathaus (Fr. Karin Binder)
Die Areale in der Seegasse, am Döblinger Friedhof und am Zentralfriedhof sind frei zugänglich.