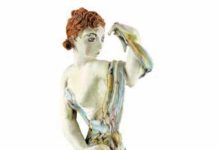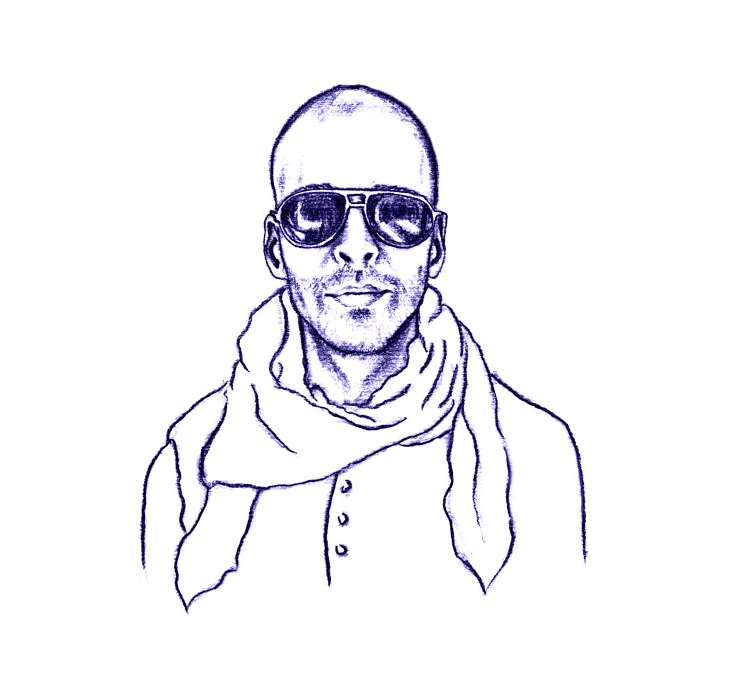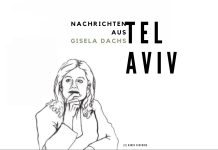Andreas Kranebitter: Ich bin kein ausgebildeter Historiker, sondern eigentlich Soziologe und Politikwissenschafter mit einem starken historischen Interesse. Im Zug meiner Tätigkeit für die Gedenkstätte Mauthausen bin ich draufgekommen, dass es da aber einen Synergieeffekt gibt, wenn man mit einem soziologischen Blick zum Beispiel an das Thema Datenauswertung geht. Es gab sowohl an der Gedenkstätte, aber auch am DÖW mit der namentlichen Erfassung der Opfer des Nationalsozialismus große Projekte, aus denen riesige Datenbanken hervorgingen. Und da war es mir dann als Soziologe wichtig, sich diesen Datenmengen auch mit der nötigen ethischen Verantwortung zu nähern.
I Zum einen hat die sozialstatistische Sprache grundsätzlich etwas Hartes, in dem sie Menschen zu Zahlen macht. Eine nicht sich selbst reflektierende Sozialwissenschaft, die Daten verwendet und dann als Fakten präsentiert, hat ja immer auch einen schalen Beigeschmack, selbst wenn es nur um Daten der Sozialbehörden geht. Daten in Konzentrationslagern sind aber zum Beispiel von der SS erhoben worden, mit eindeutig diffamierenden Kategorisierungen, etwa auf den so genannten Häftlingskarteikarten, in die dann wirklich aufs Allerschlimmste anthropologisch, anthropometrisch die Gesichtsform und alles Mögliche aufgenommen worden ist. Da fände ich es seltsam, wenn wir als Soziologen herkommen und das dann quasi positivistisch verkürzt als Fakten nehmen und sagen, so und so viele Personen hatten eine ovale Gesichtsform. Da muss man permanent reflektieren.
I Etwa, dass es im KZ Mauthausen genauso war wie in allen anderen Konzentrationslagern: dass in der so genannten Häftlingsgesellschaft die jüdische Opfergruppe beziehungsweise die als Juden Deportierten die geringste Überlebenschance hatten. Das lässt sich aus den Daten herauslesen, das ist auch durch Aussagen von politisch Verfolgten belegt, die etwa erzählten, dass die jüdischen Häftlinge für sie eine Art Blitzableiterfunktion hatten. Sie hatten – ich mag das Wort nicht, aber so wird es beschrieben – den „Vernichtungsdruck“ durch die SS am meisten zu spüren.
„Man denkt die Opferkategorien meist nebeneinander,
muss diese aber vielmehr zusammendenken.“
Andreas Kranebitter
I Für mich war es sehr überraschend, dass die These, dass die mit Geld es eher geschafft haben zu fliehen und die Ärmeren im Holocaust vernichtet wurden, so nicht stimmt und dass sich eigentlich kein sozialer Unterschied festmachen lässt. Das Einzige, das sich statistisch belegen lässt, ist, dass es eine Altersfrage war. Jüngere konnten eher emigrieren, Ältere blieben eher hier. Aus Interviews weiß man, dass viele Familie die Jungen vorschickten, die dann die Älteren nachholen sollten. Und das ist oft nicht mehr geglückt.
I Ich habe es fix vor. Wie die Realität dann sein wird, ist noch einmal etwas anderes.
I Es gibt einen Bereich, der noch unterforscht ist und den ich auch für einen erinnerungspolitischen Skandal halte: die Verfolgung von als kriminell Bezeichneten. Das sind, wir haben es schon erörtert, jene, die wegen Vorstrafen, die sie vor 1938 erhielten, deportiert wurden. Über diese Gruppe hat man auch in den Jahrzehnten nach 1945 selten geredet, vor allem aber hat man das NS-Unrecht nicht anerkannt. Es wurden Menschen von der Kriminalpolizei wie Freiwild behandelt, als geborene, wesenhafte Verbrecher, die – auch auf Zuruf der Fürsorge- und Gesundheitsämter – in ein KZ zur Vernichtung durch Arbeit eingewiesen wurden. Sie hatten aber vergleichsweise kleine Vergehen begangen, zum Beispiel eben Diebstahl. Darunter fielen aber auch Delikte wegen so genannter Unzucht, also Homosexualität.
I Allein im KZ Mauthausen gab es an die 4.000 Betroffene, in ganz Österreich dürften an die 10.000 Menschen unter dem Etikett „Berufsverbrecher“ deportiert worden sein. Ich habe auch mit Angehörigen gesprochen, diese Familien fühlen sich alleine gelassen. Bis heute fallen diese Verfolgten aus dem Opfer-Narrativ heraus. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die Verfolgung nicht von der Gestapo organisiert wurde, sondern von der Kriminalpolizei, die ja immer als die saubere Polizei galt. Aber das stimmt so eben nicht.
„Es ist für mich in die DNA des DÖW eingeschrieben,
dass man sich in seiner Arbeit nicht von Angriffen beirren lässt.“
Andreas Kranebitter
I Das ist für mich eine wesentliche Erfahrung gewesen, ein Archiv mit all seinen Licht- und Schattenseiten kennenzulernen. Archivarbeit bedeutet auch viel trouble shooting: Was tun bei einem Wasserschaden? Da beginnt in einem Archiv der Schimmel zu fliegen. Man muss hier also auch die Materialität der Dinge wirklich gut kennen. Man muss wissen, wie man Objekte aufbewahrt, aber auch, wie man elektronische Aufnahmen sichert, ohne dass sie irgendwann nicht mehr abspielbar sind. Und da ist beim DÖW räumlich viel zu tun, deswegen ist die Übersiedlung auf das OttoWagner-Areal auf den Steinhof-Gründen nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine wirkliche Chance. Es braucht bessere klimatische Bedingungen für die Aufbewahrung von Schriftgut und Fotos, sonst haben wir hier früher oder später ein Problem.
I Wenn alles wie geplant läuft, könnten wir in zwei Jahren übersieden. Dort werden sich leichter moderne archivarische Bedingungen herstellen lassen. Gleichzeitig muss man auch schauen, wie man mit dem historischen Ort umgeht. Wir werden kontextualisieren und sichtbar machen müssen, wo wir da eigentlich sind. Bereits jetzt verantwortet das DÖW auf dem Areal die Gedenkstätte Steinhof, dort gibt es die Ausstellung über Medizinverbrechen.
I Was mir wichtig ist, ist, die Sichtbarkeit des DÖW zu erhöhen. Es passiert viel Tolles hier – vom Forschungsbereich über die Dokumentation bis zur Vermittlung. Das, was die Kollegen und Kolleginnen hier leisten, hat mehr Sichtbarkeit verdient. Da geht es um SocialMedia-Auftritte genauso wie um die Website, um die Präsentation unserer Publikationen, um eine aktivere Medienarbeit. Es ist zwar auch wichtig, reaktiv auf die Bedürfnisse von Medien einzugehen, etwa, wenn es aktuell um Rechtsextremismus geht, aber die Arbeit im Rechtsextremismus-Bereich ist eine stetige. Dort wird Forschung betrieben, gemonitort, nicht nur national, sondern zum Beispiel auch über Ungarn und über Minderheiten in Österreich wie die Grauen Wölfe. Das ist unabhängig vom einzelnen medialen Ereignis. Und diese Expertise müssen wir noch stärker zeigen. Wir betreuen ja auch nicht nur unsere Ausstellungen, da passiert auch Vermittlungsarbeit. Die Kollegen und Kolleginnen arbeiten in Workshops mit Schülerinnen und Schülern, all das verdient auch Aufmerksamkeit.
Woran ich auch denke, ist, an frühere Publikationen des DÖW anzuschließen. Ich bin mit den kompakten Monografien für Zeitgeschichte aufgewachsen, diese kleinen Heftchen im Europa Verlag von Hermann Langbein, Ella Lingens, Selma Steinmetz, die schon in den 1960er- und 1970er-Jahren gemacht worden sind und die viel bewegt haben. Mir fehlt momentan eine Überblicksdarstellung des Holocaust in Österreich. Es gibt viele Publikationen und viel Detailforschung, aber all das gehört nun synthetisiert, zusammengeführt und für einen größeren Leser- und Leserinnenkreis verständlich aufbereitet. Dabei muss integriert Verfolgung und Widerstand mit einem Fokus auf Täter und Opfer dargestellt werden. Im DÖW hat all das übrigens von Anfang an stattgefunden, es wurde von Beginn an alles zusammengedacht.

I Ich verstehe die Frage, aber gerade das DÖW ist eine Gründung von Überlebenden – sowohl von im Widerstand Tätigen wie auch von Holocaust-Überlebenden. Das ist auch seine Einzigartigkeit. Das DÖW zeigte von Beginn an, dass es nicht ausschließlich auf politisch Verfolgte fokussiert hat. Unter den Gründern und Gründerinnen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen waren auch Verfolgte, die ein KZ oder als U-Boot überlebt haben oder aus dem Exil zurückgekommen sind. Wichtig ist auch, dass es sich beim DÖW eben um eine selbstorganisierte Bewegung handelt, eine unabhängige Einrichtung, die überparteilich gegründet wurde. Erst seit sich die Diskurse verändert haben, kann das DÖW mit der Unterstützung von Teilen der Politik rechnen. Zum Glück,
I Was man beobachten kann: In vielen dieser Einrichtungen gibt es gerade einen Generations- beziehungsweise Leitungswechsel. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten der Kooperation, bilateral und multilateral. Ich bin ein großer Freund von Kooperationen. Und ich denke, dass neue Projekte und Ideen koordinierter angegangen werden sollten. Dazu wird es manchmal nötig sein, individuell wie institutionell über das eigene Ego zu hüpfen. Ein Beispiel: Wenn Ministerin Karoline Edtstadler medial ein Gedenkbuch ankündigt, hätte ich mir gewünscht, dass man das vorher auch gemeinsam bespricht.
I Grundsätzlich sind wir eine unabhängige und überparteiliche Organisation. Dafür ist es auch wichtig, auch auf der organisatorischen Ebene eine gewisse Distanz zur Politik und zur Tagespolitik zu haben. So können wir auch gegenüber den uns unterstützenden und im antifaschistischen Konsens befindlichen Parteien unabhängig auftreten. Das haben wir immer getan, und das tun wir auch weiter. Das andere ist, sich von Parteien wie der FPÖ nicht einschüchtern zu lassen. Es ist für mich in die DNA des DÖW eingeschrieben, dass man sich in seiner Arbeit nicht von Angriffen beirren lässt. Das DÖW ist von Personen gegründet worden, die versteckt überlebt haben, die trotz Verfolgung im Widerstand tätig waren, die Konzentrationslager überlebt haben. Man wird daher jetzt nicht aus Angst vor einer Klage seine Arbeit nicht publizieren.
I Ich wundere mich schon, wie die ÖVP Niederösterreich über so viele Dinge hinwegsehen kann, die die am rechtesten Rand der Partei befindliche FPÖ Niederösterreich tut. Und das sind durchaus auch Dinge, die das Kerngebiet des DÖW betreffen. Wenn Personen in den Landtag einziehen, die Menschen wie Franz Jägerstätter als Verräter verunglimpfen, stellt das einen mühsam über Jahrzehnte erkämpften Konsens in Frage. Nämlich, dass Menschen, die sich dem Dienst der Wehrmacht entzogen haben, zu ehren sind – nicht zu diffamieren. Wie man darüber hinwegsehen kann, ist mir schleierhaft.