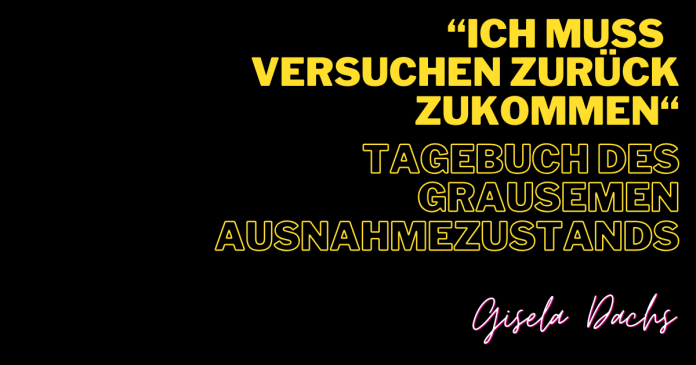Samstag In Montreal ist es noch mitten in der Nacht. Ich bin seit zwei Tagen hier auf einer Konferenz und noch im Jetlag. Im Halbschlaf höre ich WhatsApp-Nachrichten auf meinem Handy eintreffen, denke mir nur, dass die Absender ja nicht wissen, dass ich mich in einer anderen Zeitzone befinde. In Israel ist es ja schon morgens. Irgendwann schaue ich dann doch nach. Es sind viele Anfragen von Medien. Etwas muss passiert sein. Als ich zuhause anrufe, geht das Gespräch direkt in den Bunker. Tel Aviv wird gerade beschossen. Von einem Anschlag der Hamas im Süden ist die Rede. Auf CNN gibt es Interviews mit Experten, die in London sitzen und in üblichen Phrasen den Nahostkonflikt analysieren. Bald aber zeichnet sich ab, dass gerade etwas Präzedenzloses abläuft. Von vierzig Toten ist die Rede.
Ich muss zur Konferenz, auch ein junger Kollege aus Israel ist dabei. Er sieht ein Bild im Netz, das ihn in eine Panikattacke versetzte. Er möchte mir lieber nicht sagen, was genau da drauf war. Nur so viel: Es geht um eine verschleppte Israelin, als Hamas-Trophäe. Bis abends steigt die Zahl der Toten unablässig, wir finden uns fehl am Platz, umgeben von Menschen, die zwar ihr Entsetzen oder Mitgefühl ausdrücken, aber letztlich null Ahnung haben von Israel. Wir wollen nach Hause.
Air Canada streicht die Flüge nach Tel Aviv. Ich muss versuchen, trotzdem irgendwie zurückzukommen.
Sonntag Es ist Krieg. Israel gegen die Hamas. Air Canada streicht die Flüge nach Tel Aviv. Ich muss unbedingt nach Hause kommen. In Paris und Berlin leuchten israelische Nationalfarben auf Eiffelturm und Brandenburger Tor. Nicht weit vom Hotel gibt es eine Pro-Hamas-Demonstration.In Israel beginnt man langsam und unter anhaltendem Raketenbeschuss, das gewaltige Ausmaß des Anschlags zu begreifen.
Montag Es gibt einen Flug via London.
Dienstag Tag vier nach dem Großangriff der Hamas auf Israel. Einer der wenigen Flüge, die es noch gibt, bringt mich zurück nach Tel Aviv. Zur Landung ändert die Maschine der British Airways ihren Kurs. Sie nähert sich von Norden und weicht so den Raketen aus, die die Hamas gut getimt zum Empfang abfeuert. In der Ankunftshalle ist es ungewöhnlich still. Wartende starren unablässig auf ihre Telefone, tippen Nachrichten. Der Schock steht in den Gesichtern. Auch der Taxifahrer sagt kein Wort auf dem Weg in die Innenstadt. Zuhause signalisiert das Licht über der Kellertreppe, der Schutzraum ist offen. Am Samstag hat nur 90 Meter von hier eine Rakete in ein Haus eingeschlagen.
Im vierten Stock stelle ich den Koffer ab, dann geht die Sirene los, also erst einmal hinunterlaufen. 90 Sekunden bleiben einem, um sich in Sicherheit zu bringen. Purer Luxus verglichen mit den Verhältnissen im Süden. Dort gibt es seit Samstag nicht nur einen permanenten Raketenhagel – wenn die Sirene losgeht, bleiben dort nur zehn Sekunden.
Ein Mann kauft Gedenkkerzen, da ist gerade Nachschub eingetroffen. Wer kann, hilft den Überlebenden.
Es ist nicht das erste Mal, aber diesmal ist alles anders. Dauernd wächst die Zahl der Ermordeten, inzwischen schon mehr als tausend. Eine Freundin schreibt mir, dass ihre Yoga-Partnerin vermutlich zu den 150 Gekidnappten der Hamas gehört. Das Letzte, das man von der 74-jährigen Vivian Silver gehört hat, war, dass sie hinter einem Schrank in ihrem Schutzraum im Kibbuz Beeri kauerte. Nach dem letzten Gazakrieg 2014 hat sie eine israelische Grassroots-Friedensbewegung gegründet. Nachdem in Beeri hundert Leichen, darunter viele bestialisch ermordete Babys, geborgen wurden, ist der Kibbuz jetzt nur mehr eine einzige abgebrannte Ruine. Innerhalb von 48 Stunden wurde dort jegliches Leben brutal ausgelöscht. Die Bilder sind nicht zu ertragen.
In den Abendnachrichten heißt es, dass die Gegend in der Nähe zum Gazastreifen inzwischen frei von Hamas-Terroristen sei. Nicht sicher aber ist, ob sich nicht einige versteckt haben, um zu gegebener Zeit aus ihrem Versteck zu kommen; zudem gibt es die Sorge, dass Sympathisanten unter arabischen Israelis Anschläge begehen könnten. Aus der pulsierenden Mittelmeermetropole ist eine Geisterstadt geworden.
Ich war nur ein paar Tage weg und bin in ein anderes Land zurückgekehrt.
Mittwoch Im Supermarkt in meinem Viertel fehlen Nahrungsmittel. Es ist die Folge einer kurz danach widerrufenen Aufforderung, sich mit Proviant für 72 Stunden auszustatten. Ein Mann kauft Gedenkkerzen, da ist gerade Nachschub eingetroffen. Wer kann, hilft den Überlebenden. In meiner Straße werden Spielsachen gesammelt, Stofftiere und Kinderbücher. Sie sind für die Evakuierten aus den von der Hamas niedergebrannten Orten in der Nähe des Gazastreifens gedacht.
Die Protestbewegung, bis vor Kurzem noch mit der Verhinderung des Justizumbaus beschäftigt, hat nahtlos umgeschaltet auf ziviles Engagement. Eine der Sammelstellen ist das prominente Restaurant Achim, unweit der Kaplan Street, auf der neun Monate lang wöchentlich demonstriert wurde. Vor dem Eingang stehen Autos Schlange, um Spenden abzuladen. Durch Crowdfunding wurden auch kugelsichere Westen, tragbare Ladegeräte, Essen und Kleidung für Soldaten organisiert. Größer könnte der Kontrast zur Unfähigkeit der Regierung nicht sein. Man hört so gut wie gar nichts von den offiziellen Verantwortlichen, die sich mit so schönen Namen wie das „Ministerium für Negev, Galiläa und nationale Resilienz“ geschmückt haben. Es ist die Heimatfront, die das Vakuum ausfüllt. Die vor Kurzem noch als Anarchisten beschimpft wordenen Demonstrant:innen sind zur Stelle, als Helferinnen und Reservisten, und versuchen, das Land zu retten.
Die vor Kurzem noch als Anarchisten beschimpft wordenen Demonstranten sind zur Stelle, als Helfer und Reservistensoldaten, und versuchen, das Land zu retten.
Seit heute gibt es endlich eine Notstandregierung. Das kleine Kabinett muss den Menschen jetzt erst einmal ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, es muss gegen den Kontroll- und Vertrauensverlust angehen, der sich wie ein riesiges schwarzes Loch aufgetan hat. Premier Benjamin Netanjahu ist unfähig, tröstliche Worte zu finden; an seiner Seite sind jetzt Verteidigungsminister Joaw Gallant und Benny Gantz aus der Opposition. Aber die bisherige Regierung bleibt anscheinend auch weiter bestehen, hinzugefügt wurden jedenfalls noch fünf Minister.
Jetzt heizt sich auch die Nordgrenze auf. Die Angst vor Angriffen der noch viel schlagkräftigeren Hisbollah an einer zweiten Front ist groß. Die gestrige Ansprache von US-Präsident Joe Biden klingt noch beruhigend im Ohr. Sein Mitgefühl war hörbar. Israel könne auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten zählen. In Richtung Teheran und dessen Handlangern im Libanon richtete er die eindringliche Warnung, sich nicht einzumischen: „Just don’t!“
Donnerstag Alltag im Ausnahmezustand. Die Schulen und der Strand haben zu, Wolt-Fahrer rasen mit ihren E-Bikes durch die Straßen, um Mahlzeiten zu liefern. Es erinnert ein bisschen an Corona-Zeiten, aber ein paar Cafés sind offen. Nicht-Israelis verlassen das Land, sofern es ihnen möglich ist. Ausländische Bürgerinnen und Bürger bekommen die Möglichkeit zur Evakuierung, auf dem Landweg via Jordanien, per Schiff und mit Sonderflügen. Die Einheimischen bleiben zurück wie auf einer Insel.
Israel ist ein kleines Land, jeder kennt jemanden, der Nahestehende verloren hat, wenn er nicht selbst direkt betroffen ist. Der Neffe einer Kollegin ist unter den Getöteten. Sein Bild ist heute in der Zeitung. Lauter junge Gesichter. Und viele suchen immer noch nach Angehörigen, nicht zu reden von den Familien der Entführten, die schier verzweifeln bei dem Gedanken daran, was mit den Großmüttern, Frauen und kleinen Kinder dort in Gaza wohl gerade passiert.
In den sozialen Medien gibt es immer mehr Posts, in denen Augenzeugen von den Gräueltaten berichten. Traumatisiert sind auch jene, die in den von der Hamas angegriffenen Dörfern gesamte Familien bergen müssen, abgeschlachtet in ihren Betten. Sie fanden geschändete Leichen von Babys und schwangeren Frauen.. „Die jungen Soldaten haben kein Wort mehr herausgebracht, als sie danach zu ihrem Stützpunkt zurückkehrten“, erzählt eine Offizierin. Schlimmer als die Schergen vom Islamischen Staat.
Immerhin kommen wichtige Besucher. Gestern der britische Außenminister, der bei Raketenalarm mit in die Schutzräume lief, heute der amerikanische Verteidigungsminister, morgen die deutsche Außenministerin. Die ausländische Solidarität tut den Israelis gut, aber sie fragen sich auch, wann das kippen wird.
Denn bei den israelischen Angriffen gegen die Hamas kommen auch unschuldige Palästinenser ums Leben. Je mehr, umso besser aus der Sicht der Hamas. „Die Strategie ist klar“, sagt ein Sprecher der israelischen Armee, „es geht darum, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza zu maximieren und sie alle das Massaker an Israelis vergessen zu lassen, das diesen Krieg überhaupt erst ausgelöst hat.“ Solche asymmetrischen Kriege, in denen der Gegner die eigenen Toten als Pluspunkte im Imagekampf ansieht, sind schwer zu gewinnen. Aber genau deshalb hat die Hamas ihre militärische Infrastruktur bewusst inmitten der Zivilbevölkerung angelegt.
Freitag Der Staat Israel ist Ende des 19. Jahrhunderts ersonnen worden, um Jüdinnen und Juden vor Pogromen zu schützen. Seine offizielle Gründung folgte erst nach dem Holocaust. Seither sind nie mehr so viele Juden und Jüdinnen an einem Tag ermordet worden wie jetzt.
Unter den Entführten in Gaza sind auch Holocaust-Überlebende. Wie muss es ihnen gehen? Über der HaYarkon Street in Tel Aviv hängt ein schwarzes Banner: „Am Israel Chai – das Volk Israel lebt.“ Auf Instagram zirkuliert ein zweigeteilter Davidstern, halb gelb, wie ihn die Nazis den Juden vorgeschrieben haben, halb in den israelischen Nationalfarben: „Niemals wieder ist jetzt“, steht darunter.
Wenn alles vorbei ist, wer weiß wann, bleibt wahrscheinlich auch politisch kaum mehr ein Stein auf dem anderen.
Was aber darf nun sein im Verteidigungskampf, und wo geht er zu weit? Was genau bedeutet Verhältnismäßigkeit, wie sie vom Ausland eingefordert wird? Das sind keine neuen Fragen, aber diesmal stellen sie sich anders. Es geht um das eigene Selbstverständnis als Staat. Es geht darum, einen barbarischen Feind zu besiegen, dem es weder um einen Palästinenserstaat neben Israel geht noch um das Wohlbefinden der eigenen Bevölkerung.
Auch seit heute Morgen feuert die Hamas wieder unablässig Raketen auf Israel, um 12:18 Uhr auch auf den Großraum Tel Aviv. Direkteinschläge in Aschkelon. Der „Iron Dome“ kommt nicht nach, wenn Raketen im Bündel abgefeuert werden. Man fragt sich, wie sie immer noch so viele haben. Der gesamte Gazastreifen muss unterkellert sein mit Waffenlagern und mobilen Abschussrampen. In einem Video zeigen die Islamisten, wie sie Raketen mit herausgerissenen Wasserleitungen bauen. Wie lässt sich das stoppen?
Gerade wurde eine Million Menschen in Gaza aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden ihre Häuser zu evakuieren. Die Hamas fordert sie auf zu bleiben. Sie behauptet auch, dass bei den israelischen Bombardierungen Geiseln getötet worden seien.
Die Bilder von palästinensischen Großfamilien auf der Flucht, auf Pferdewägen inmitten von Ruinen, sind herzzerreißend. Sie lassen auch die Menschen hier nicht unberührt, sie sind nicht die Gegner, Israels Kampf ist gegen die Hamas. Doch bevor man sich um das Wohlbefinden der Zivilbevölkerung in Gaza kümmere, sagt der Ex-Militär Yossi Kuperwasser in einer Zoom-Pressekonferenz, muss man erst einmal schauen, dass die Israelis überleben. „Die Hamas muss so unter Druck geraten, dass sie es so bald nicht wieder versucht.“
17 Uhr Raketen auf Tel Aviv. Direkteinschlag in Rechovot.
Samstag Schabbat, Ruhetag. Aber Züge dürfen heute trotzdem fahren. Nichts mehr ist wie gehabt. Wenn alles vorbei ist, wer weiß wann, bleibt wahrscheinlich auch politisch kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Die „Erklärungsministerin“ Galit Distel, seit einer Woche wie vom Erdboden verschluckt, ist als Erste zurückgetreten. Eine breit bejubelte Entscheidung. Keine Facebook-Claqueure mehr, wie bisher. Jetzt ist nicht die Zeit, mit all den Unfähigkeiten abzurechnen. Aber sie wird kommen. Bis dahin wirft man die Minister einfach hinaus, sollten sie es wagen, irgendwo aufzutauchen. Wie zuletzt die Transportministerin Miri Regev, als sie Verletzte im Krankenhaus besuchen wollte.
Aus Eilat meldet sich eine Mutter, die mit ihrem Kind von ihrem Heimatort in der Negevwüste evakuiert wurde. Sie fühlt sich von der Regierung verraten, „Wir hatten alle Angst vor einem solchen Szenario, aber nicht eines, in dem die Armee zehn Stunden gebraucht hat, um vor Ort zu sein.“
Andere Familien aus der Nähe des Gazastreifens sind jetzt am Toten Meer. Sie sind nicht sicher, ob sie je wieder in ihre Kibbuzim zurückwollen, ob sie überhaupt in Israel bleiben wollen. Doch wohin? In Paris gab es gerade eine ganze Reihe antisemitischer Anschläge, im Berliner Bezirk Neukölln feiert man die „Heldentaten“ der Hamas.
An moralischer Klarheit aber fehlt es offenbar auch bisherigen Verbündeten. In normalen Zeiten ist die hiesige akademische Welt eng mit internationalen Eliteuniversitäten verbunden. In einem Brief an ihre Kollegen in Harvard und Stanford bedauert die Leitung der Hebräischen Universität, dass diese es in ihrer Erklärung nicht geschafft haben, den Massenmord an Jüdinnen und Juden zu kritisieren. Leider werde nur einem Wert beigemessen: die universitäre Gemeinschaft zusammenzuhalten. „Das ist kein Krieg wie bisher. Oder ein weiteres Kapitel im israelisch-palästinensischen Konflikt. Es gibt nicht ,gute Leute auf beiden Seiten‘. Der Staat Israel beginnt eine Militärkampagne, um die Hamas zu entmachten, damit sich so etwas nicht wiederholt.“
Universitäten veröffentlichen eine lange Liste ihrer Ermordeten und Gefallenen. Der Beginn des Herbstsemesters ist verschoben, ein Drittel der Studenten und Studentinnen sind als Reservist:innen im Einsatz.
Wie wird es weitergehen? Ein Ausblick fällt gerade schwer. Die prominente Schriftstellerin Zeruya Shalev betet darum, dass sich bei Kriegsende „die einzige Teilung abzeichnet, die in dieser Region möglich ist, keine Teilung zwischen Arabern und Juden, sondern zwischen Moderaten und Extremisten, zwischen Pragmatikern und Fanatikern“. Und es gibt ja vielleicht noch eine wegweisende Heldin: Rachel aus Ofakim. Zwanzig Stunden lang befand sie sich in ihrem Haus in der Geiselhaft von fünf Hamas-Terroristen. Bis sie befreit werden konnte, bekochte sie die Männer, servierte ihnen Kaffee und Kekse und erzählte von ihrer Kindheit in Marokko. Auf TikTok wurde sie schon als Präsidentin vorgeschlagen.