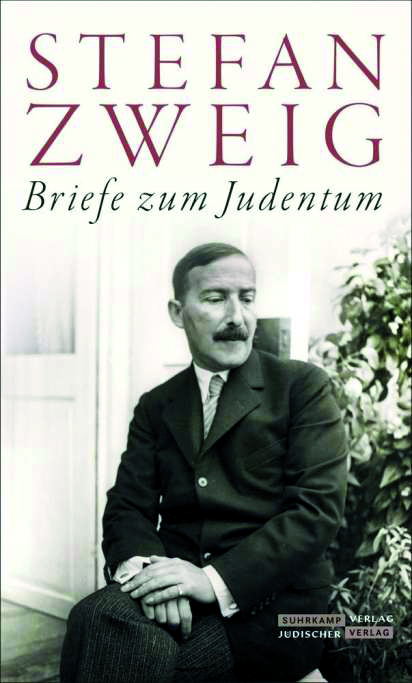Mit der Bitte um absolute Verschwiegenheit und der Bedingung, niemandem bis zehn Jahre nach seinem Tod Einblick zu gewähren, überlässt Stefan Zweig eine „Auslese“ seiner „Privatkorrespondenz“ der jüdischen Universitäts- und Nationalbibliothek in Jerusalem, „für unsere Bibliothek“, wie er Direktor Hugo Bergmann am 11. Dezember 1933 schreibt.
Mit 52 Jahren ist er dabei, seinen Hausstand am Salzburger Kapuzinerberg aufzulösen und ein unstetes Wanderleben als Emigrant zu beginnen, das ihn vorerst nach London führen wird. Im Mai davor waren seine Bücher in die Flammen geworfen worden und kein einziger der „nichtverbrannten“ deutschen Schriftstellerkollegen hatte dagegen das Wort ergriffen.
Dass er diesen höchst wertvollen persönlichen Schatz der Korrespondenz unter anderen mit Größen wie Einstein, Freud, Herzl, Joyce und Thomas Mann gerade nach Jerusalem schickt, ist allerdings überraschend, wenn man seine Stellung zum Zionismus und zu Palästina betrachtet, wie sie sich gerade in Zweigs Briefen zum Judentum niederschlägt, die der deutsche Historiker und Judaist Stefan Litt in einem neuen Band versammelt hat.
Geliebte Diaspora. Seinen frühen Förderer und Mentor Theodor Herzl wird Zweig stets liebend verehren und schätzen, für dessen Idee eines Judenstaats kann er sich allerdings nie begeistern.
„Wir können nicht mehr, nachdem wir 2000 Jahre die Welt mit unserem Blut und unseren Ideen durchpflügt, uns wieder beschränken, in einem arabischen Winkel ein Natiönchen zu werden. Unser Geist ist Weltgeist […]. Es hilft nichts stolz auf das Judentum zu sein oder beschämt – man muss es bekennen […] wie es eben unser Schicksal ist, nämlich heimatlos im höchsten Sinne.“ Meint Zweig im Juli 1920.
„Wir können nicht uns beschränken, in einem arabischen Winkel ein Natiönchen zu werden.“
Stefan Zweig
Als Kosmopolit und Pazifist lehnt er jeden, auch den jüdischen Nationalismus ab und erörtert diesen Standpunkt in vielen Briefen an durchaus anders Gesinnte. Je mehr sich der „gefährliche Traum eines Judenstaates“ zu verwirklichen drohe, umso mehr liebe er „die schmerzliche Idee der Diaspora“, schreibt er etwa 1918 an Martin Buber. Mit dem späteren ersten Präsidenten Israels, Chaim Weizmann, pflegt er dennoch regen Gedankenaustausch.
An seine jüdischen Dichterkollegen wie Max Brod, Schalom Asch, aber auch Felix Salten und Franz Werfel wendet sich Zweig Mitte der 1930er-Jahre mit der etwas blauäugigen Idee eines Manifests, einer Art literarischen Protest gegen den Antisemitismus der NS-Führung, der auf Zweigs politische Naivität weist, mit Worten gegen die Gewalt auftreten zu können.
Im Gegensatz dazu steht seine realistische, ja hellsichtige, wenn nicht gar prophetische Einschätzung der sich anbahnenden „jüdischen Tragödie“, die sich für ihn immer mehr in „die Tragödie des Judeseins“ verwandelt.
„Ich habe es seit fünf Jahren gewusst“, schreibt er an seinen innigen Freund Schalom Asch im März 1938 aus London. Seine katholisch getaufte erste Frau und ihre Töchter hingegen wollten nicht weg aus Österreich und hätten nun schwer gebüßt, dass sie „nicht Juden sein, nicht als Juden gelten wollten“. Dass er selbst dem Judentum „nie abtrünnig sein will und werde“, bekennt der keineswegs religiös erzogene Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie schon 1916 in einem Brief an Martin Buber.
Archetypisch. Seine idealistische Vorstellung eines universalen, allein durch die Macht des Geistes wirkenden Judentums spiegelt sich vor allem in seinen thematisch einschlägigen Werken wie unter anderen in Jeremias, am deutlichsten aber in der Legende Der begrabene Leuchter, welche die 1.000-jährige Geschichte der aus dem Tempel Salomos geraubten Menora als dichterisches Symbol für das „jüdische Schicksal“ behandelt, wie er in einem Brief an Albert Einstein erklärt.
„Ich vermag nichts als mitzuleiden […] und sogar noch vorauszuleiden, was jetzt Millionen noch zugedacht ist“, schreibt er 1939 verzweifelt aus England an Felix Braun. Der letzte Brief des Bandes ist im Herbst 1941 an den Rabbiner von Persepolis gerichtet, der ihm offenbar eine Ehrung, vielleicht einen Aufruf zur Thora, im G-ttesdienst zu den Hohen Feiertagen zugedacht hat, eine Ehre, der Zweig nicht nachkommen kann, da er „wie die meisten Österreicher sehr lax in Dingen des Glaubens erzogen wurde“.
Stefan Zweigs in vieler Hinsicht archetypischen Weg als österreichischer Jude und als „deutscher Schriftsteller jüdischen Stammes“ dokumentieren die 120 ausgewählten Briefe quasi im Originalton. Fast durchwegs an Juden und Männer gerichtet, umfassen sie den Zeitraum von 1900 bis wenige Monate vor seinem Selbstmord 1942 gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte im brasilianischen Persepolis, mit dem er diesem für ihn aussichtslosen Weg ein Ende setzte.