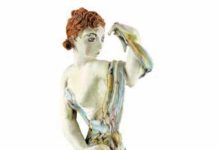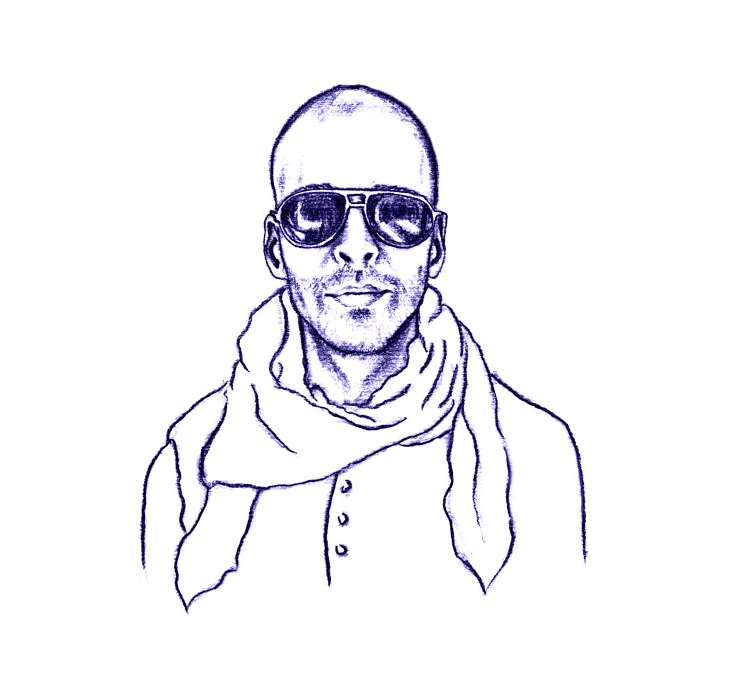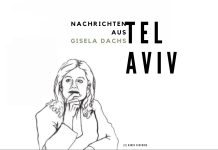Woher kommt die Verbundenheit der langjährigen steirischen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic zur jüdischen Gemeinde? Dieser Frage ging IKG-Ehrenpräsident Ariel Muzicant in einem Podiumsgespräch mit der ÖVP-Politikerin im Gemeindezentrum auf den Grund – ein Abend mit durchaus überraschenden Einblicken. Dokumentation: Alexia Weiss
Ariel Muzicant: Mich haben viele Menschen gefragt: Welche Verdienste machen die Frau Klasnic aus? Dass Sie eines Tages Landeshauptfrau der Steiermark werden, haben Sie sich wohl in jüngeren Jahren nicht zu erträumen gewagt.
Waltraud Klasnic: Ich hatte das Glück, im Oktober 1945 geboren zu werden, das heißt, der Krieg war vorbei. Meine Mutter war nicht in der Lage, mich groß zu ziehen. Das heißt, sie wollte mich nicht. Ich habe Pflegeeltern gefunden, die auch ausgebombt waren, aber ich hatte eine sehr liebevolle und gute Kindheit. Wir waren arm, aber wir haben ein Dach über dem Kopf gehabt.
Ich war in der Volksschule, in der Hauptschule. An einem Freitag bin ich heraus aus der Hauptschule, und am Montag musste ich arbeiten gehen. Das heißt, ich habe keinen Beruf. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe kein Diplom, kein Zeugnis, aber ich habe immer versucht, an mir selber zu arbeiten. Und es gibt viele Menschen, die mir dabei geholfen haben.
Allerdings habe ich auch erleben müssen, was es bedeutet, wenn man nicht überall willkommen ist – so durften die Nachbarskinder nicht mit mir spielen, weil ich „Barackengesindel“ war. Ich habe es also selber erlebt, was es heißt, ausgegrenzt zu werden. Und ich habe immer gedacht, später, wenn ich die Möglichkeit habe, Entscheidungen mitzutragen, möchte ich niemand Fremden, dem es nicht so gut geht, der nicht im Wohlstand lebt, ausgrenzen.
Ich habe es selber erlebt, und es ist mir wichtig, dass Sie das einmal erzählen – dass Sie eine ganz besondere Sensibilität entwickelt haben, was die jüdische Gemeinde betrifft. Wie sind Sie aber überhaupt in die Politik gekommen?
Das war eigentlich Zufall. Ich habe mit 18 sehr jung geheiratet, mit 24 habe ich schon drei Kinder gehabt, war berufstätig; ich habe in einem Kindermodengeschäft gearbeitet. Mein Leben spielte sich ab zwischen Beruf und Haushalt. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, es muss sich etwas bewegen im Ort. So habe ich 1970 eine Ortsgruppe der Österreichischen Frauenbewegung ins Leben gerufen. 1970 gab es noch wenige Frauen in der Politik, ich war dann eine von zwölf Gemeinderätinnen in der Steiermark und die jüngste damals. Dann bin ich in den Bezirk gekommen, und von dort ging es weiter.
Sie spüren, wie es uns geht. Sie waren jemand, bei dem man sich „ausweinen“ konnte. Worauf geht das zurück?
Es hat mich unter anderem eine jahrzehntelange Freundschaft mit dem Präsidenten der Kultusgemeinde Graz, Kurt Brühl, verbunden.
Kurt Brühl war ein enger Freund meines Vaters, und da mein Vater früh verstorben ist, hatte er ein besonderes Verhältnis zu mir. Und ich habe oft von ihm gehört, dass es ohne Sie, ohne ihre Vorgänger, nicht möglich gewesen wäre, in der Steiermark wieder eine Kultusgemeinde zu eröffnen. Er hat mir aber auch immer erzählt, wie er kämpfen musste, um das Kaufhaus seines Vaters zurückzubekommen, die Auseinandersetzungen mit den Mitbewerbern, die Ariseure waren.
Die Anfänge des Wiederaufbaus waren bereits vor mir. Mir ist das Thema aber wichtig, es ist Teil der Geschichte. Im November 2000 wurde die Synagoge eröffnet – sie ist etwas Besonderes. Und es gibt in der Stadt niemanden, der nicht stolz ist, dass diese Synagoge steht.
„Ich habe kein Diplom, kein Zeugnis, aber ich habe immer versucht, an mir selber zu arbeiten. Und es gibt viele Menschen, die mir dabei geholfen haben.“ W. Klasnic
Das ist eine von vier Synagogen, die ich eröffnen durfte. Es war mir ein großes Anliegen, nicht nur Dachböden zu bauen, sondern auch Synagogen. Woran es halt mangelt, ist jüdisches Leben in Graz. Kurt Brühl war nicht nur Präsident, sondern auch Portier, Sekretär, er war alles. Er war die Kultusgemeinde. Die Sorge ist – die Kultusgemeinde Graz hat zirka 70, 80 Personen –, wie sich eine solche Gemeinde erhalten und überleben soll. Das ist auch der Grund, dass wir der Kultusgemeinde Graz unter die Arme greifen und schauen, dass das fortgesetzt wird. Wie ist dieses Rekonstruieren einer ganz kleinen Gemeinde in Graz angekommen? Brühl hat immer wieder von Drohungen, Schmähungen, Beschimpfungen erzählt. Er hat gesagt, du bist in Wien und hast es gut, aber ich bin alleine in Graz.
Wenn man ein Geschäft hat, muss man auch etwas verkaufen. Und es hat ganz sicher Menschen gegeben, die dort nicht hingegangen sind. Das hat er sicher gespürt. Aber er hat nicht aufgegeben, er war geschätzt und anerkannt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es sind heute ja Menschen da, die weiterarbeiten. Wir haben nicht nur die Synagoge, sondern auch ein kulturelles Angebot. Wenn die Intendantin im Schauspielhaus zum Beispiel das Stück Hakoah zeigt. Hakoah war ausverkauft, alle Vorstellungen.
Gehen wir zu den Restitutionsgeschichten. Zunächst war es einmal so, dass es nach der Einigung oder Nichteinigung von Washington (2001, Anm.) keine Rechtssicherheit gab. Und da gab es eine Gruppe, die hat gesagt, wir leisten einen Beitrag – das war die Landeshauptleutekonferenz 2003.
Das war nicht einfach, auch nicht für die Landeshauptleute. Aber man muss sagen, dass überhaupt Geld da war, hat Josef Pühringer, der Vorsitzende, in die Hand genommen und durchgezogen. Da hat er nicht mich als Souffleuse gebraucht.
Das war schon seine Überzeugung.
Der Schwerpunkt bei der Landeshauptleutekonferenz war, dass es um einen hohen Betrag ging, um 18 Millionen Euro – neun zahlen die Länder, neun der Bund. Aber die Länder haben gesagt, wir zahlen, wenn der Bund gezahlt hat, und umgekehrt. Dann gab es noch die Auffassung, wir zahlen erst, wenn es Rechtssicherheit gibt. Die Landeshauptleutekonferenz bestand aus drei Parteien – ÖVP, SPÖ und FPÖ. In Gmunden wurden einstimmig die Zahlungen beschlossen. Aber die Frage war: Wer fängt an? Dann gab es ein Gespräch bei Ministerin Gehrer, das war auch nicht einfach. Ich bin dort gesessen mit der Ministerin und Ihnen. Jeder war davon überzeugt, im Recht zu sein. Und wenn Elisabeth Gehrer Rechtssicherheit gesagt hat, war sie auch im Recht. Sie ist nur nicht sehr sorgfältig umgegangen mit Ihnen.
Das ist schwer untertrieben.
Sie haben sich aber schon gewehrt. (Lachen.) Nach eineinhalb Stunden war es vorüber.
Ich habe geschwitzt. Wenn Ihnen eine Ministerin vis-à-vis sitzt und Sie haben das Gefühl, sie haut Sie gleich hinaus – es war eisige Kälte. Ich habe versucht, die Position der Kultusgemeinde zu vertreten. Ich wollte ein bisschen Gerechtigkeit für die jüdische Gemeinde. Es hat mich sehr viel Anstrengung gekostet, dort brav zu sitzen und den Ton zu wahren. Und wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich aufgestanden und hätte gesagt, es reicht mir. Die Kultusgemeinde hat ja nicht grundlos diese Verhandlungen geführt. Wir haben nachgewiesen, wie viele Vereine es gegeben hat, wie viel Vermögen es gegeben hat. Und dann heißt es, ihr kriegt nichts, ihr wart’s nicht brav, ihr habt am Heldenplatz gegen uns demonstriert. Wir waren in einer Sackgasse. Und Sie haben uns wie ein Zirkusdompteur zur Vernunft gebracht und gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Ich war unter einem unheimlichen Druck. Das ist, was die Menschen damals nicht verstanden haben. Da gab es 22.000 Menschen, die nichts bekommen haben, ohne jede Rechtssicherheit. Und die haben Muzicant zur Seite genommen und gesagt: Rechtssicherheit. Schließlich wurde in Washington 2001 erklärt: Das Gemeindevermögen holt euch aus dem allgemeinen Topf. Aber ich habe gesagt, wenn ich von dem wenigen noch das Gemeindevermögen wegnehme, wäre das ein jüdischer Krieg. Und auf das wollte ich mich nicht einlassen. Ich wollte als Kultusgemeinde nicht einen Cent den Opfern wegnehmen. Das war der Kampf.
Die Medien schreiben gerne, dass es so etwas wie ein Mikado gibt – wer sich zuerst bewegt. Und ich habe mir damals gedacht, die Steiermark bewegt sich zuerst. Ich habe gesagt, die Steiermark beginnt zu zahlen. Und habe mir einen Verbündeten geholt: Das zweite Land, das gezahlt hat, war Kärnten. Haider hat verstanden, dass das sein muss.
Man war mir böse, dass ich das anerkannt habe. Wie kannst du sagen, dass Haider paktfähig ist. Aber es war so. Wir haben am Ende des Tages Rechtssicherheit gehabt. Die nächste Notwendigkeit war, mit dem Bundeskanzler zu sprechen wegen des zweiten Teils der 18 Millionen. Doch Schüssel und ich hatten keine Gesprächsbasis zueinander; Sie haben auch hier vermittelt.
Wenn es nicht mehr geht zu balancieren, musst du schauen, dass die zwei, die nicht mehr miteinander können, sich finden. Und das habe ich geschafft.
ZUR PERSON
Waltraud Klasnic, geb. 1945 in Graz, langjährige ÖVP-Politikerin. 1970 Beitritt zur Österreichischen Frauenbewegung (einer ÖVP-Organisation). 1977 bis 1981 Bundesrätin, danach Wechsel in den steirischen Landtag, ab 1983 dritte Landtagspräsidentin. Ab 1988 Wirtschaftslandesrätin, ab 1993 gleichzeitig Landeshauptmann-Stellvertreterin. Von 1996 bis 2005 Landeshauptfrau der Steiermark. Klasnic ist verheiratet, Mutter dreier erwachsener Kinder sowie fünffache Großmutter.